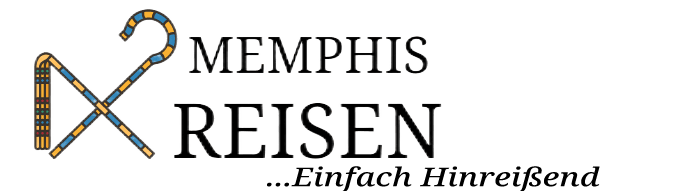Berufliche Ziele: Eine Erfolgsgeschichte
Fragt man sehr junge Menschen nach ihrer Vorstellung von einem erfolgreichen Dasein, haben die Antworten viel mit Süßkram, Schlittschuhlaufen und Daddeln bis zum Umfallen zu tun. Pubertierende äußern eine noch schlichtere Formel: viel Geld verdienen mit etwas, was Freude macht. Mit dem Alter wird es differenzierter und komplizierter, wenn Menschen sich darüber äußern, was konkret beruflicher Erfolg für sie heißt. Eine subjektive Auswahl an Antworten: zum ersten Mal operieren dürfen, eine Dienstreise nach Mailand, eine Einladung vom Branchenverband, die Steuerberaterprüfung bestehen, eine Abteilung leiten, die Teilzeitstelle gut hinbekommen und nachmittags bei den Kindern sein, eine Gehaltserhöhung.
Wer also im Bekanntenkreis nachfragt, was andere unter Erfolg verstehen, erkennt sofort, dass es hier keine Nullachtfünfzehn-Angaben gibt. Noch vor zwei Jahrzehnten wären die Antworten konformer ausgefallen. Doch die Pandemie und New-Work-Optionen haben die Definitionen von beruflichem Erfolg gründlich durchgerüttelt. Die klassischen Stichworte – Aufstieg und ein hohes Gehalt – gehen vielen nicht mehr so schnell über die Lippen. Viel Glück und Erfolg, so lautet der Standardgrußkartentext, der mittelalten oder älteren Menschen locker-flockig von der Hand ging. Jüngeren eher nicht. Ist das überhaupt eine wünschenswerte Größe, erfolgreich zu sein? Und ist das Voraussetzung zum Glücklichsein?
Wir leben in einer Welt rasanter Veränderungen. Katastrophen, aber auch Erfindungsreichtum, wie denen zu entkommen ist, verändern die Vorstellungen darüber, was Erfolg eigentlich ist. Ein Beispiel bietet das Homeoffice, entstanden mitten und wegen der Corona-Pandemie. Mittlerweile sind Arbeitsmodelle denkbar, die vorher tabuisiert und utopisch waren. Nur zweimal im Monat zum Arbeitgeber pendeln, in der Wunschregion leben und endlich mit dem Partner zusammenziehen – früher undenkbar, plötzlich möglich. Noch katapultiert so ein Arbeitsmodell nicht in die Führungsetage, befördert aber das private Glück. Ist doch auch ein Erfolg, eine stabile Partnerschaft zu pflegen! Führung in Teilzeit war noch vor wenigen Jahren revolutionär. Exotisch ist es immer noch, aber es schmückt Arbeitgeber, die sich modern positionieren.
„Ich brauche immer Ziele, egal, wie alt ich bin“
Was ist Erfolg also? Ein Wort wie ein Chamäleon. Ist das beruflicher Aufstieg? Oder „nur“ persönliche Erfüllung? Vielleicht sogar so etwas wie Ruhe und möglichst wenig Anstrengung? Oder gar: Gutes tun für andere? Das Bild von der Karriereleiter, die nach entbehrungsreicher Plackerei in der Chefetage endet, wirkt altbacken. Ein 32 Jahre alter Kollege schüttelt sich, wenn das Stichwort Karriere fällt, und sagt: „Das stößt Leute meiner Generation regelrecht ab.“ Stattdessen erscheint vielen eine entspanntere Haltung reizvoller, so in etwa: Der Weg ist vielleicht nicht das einzige, aber immerhin auch ein Ziel.
Google zum Stichwort „Erfolg haben“. Es bis irgendwohin schaffen, es weit bringen, es überhaupt zu etwas bringen, oben ankommen, seinen Weg gehen und viel aus sich machen, das alles wabert in den Köpfen. Verständlich, dass die Beraterbranche sich des Themas liebend gern annimmt. Mal seriös, mal populistisch konzentriert auf einen Aspekt – mit Geduld, Freude, Energie zum Erfolg –, garniert mit eingängigen fünf Tipps, drei Wegen, zehn Empfehlungen und vollmundigen Glücksversprechen.
Vom „Ich-Kann-Denker“ zum selbstbewussten Scheitern
Natürlich sind wir alle für schlichte Jeder-kann-alles-schaffen-Botschaften anfällig. Klingt zu verführerisch, es vom Tellerwäscher, schwups, zum Millionär zu bringen. Der Weg wird sich weisen, sofern der eiserne Wille vorhanden ist. Klar doch ist es interessant zu lesen, was der inzwischen verstorbene Psychotherapeut Rolf Merkle empfiehlt: sich selbst als „Ich-kann-Denker“ zu motivieren, weil diese zuversichtliche Haltung Erfolg beflügelt. Und auch die Empfehlung, die Biographien erfolgreicher Menschen zu lesen und sich allein durch die wohlige Lektüre persönlich zu „empowern“, wie Coaches raten, hat einen verständlichen Kern.
Michelle Obama inspirierend über ihr Vorwärtskommen von der Zweizimmerwohnung ins Weiße Haus, es gilt als eine der erfolgreichsten Autobiographien in der Geschichte des Verlagswesens. Aber die einstige Präsidentengattin ist nicht Lieschen Müller, sie ist in ihrem früheren Leben bodenständig als Michelle und nicht als First Lady gestartet und schreibt offenherzig von Misserfolgen und der Sehnsucht, Träume zu verwirklichen. Das kommt an, darin finden sich Leser wieder. Scheitern gehört dazu – wobei die beliebten Fuck-up-Nights, in denen Menschen eloquent über ihre Misserfolge plaudern, eines nicht abbilden, nämlich diejenigen, die dauerhaft scheitern.


Erfolgsbild der heutigen Zeit? Work-life-balance, Ausgleich und flexibel arbeiten: eine Sommerszene am Mainufer in Frankfurt aus dem Jahr 2022
:
Bild: Domenic Driessen
Auf die Bühne traut sich in der Regel nur, wer ein Phönix-aus-der-Asche-Modell verkörpert. Diese Menschen haben viel gewagt, viel verloren, letztendlich aber an Erfahrung gewonnen und lösen das elegant, indem sie diese Brüche mit selbstironischem Schwung verkaufen. „Eine Niederlage kann ein Erfolg sein, dann weiß ich, wo ich stehe“, sagt Jürgen Walter. Er ist unter anderem auf Verkehrspsychologie spezialisiert und erlebt Menschen, die eine Fahrprüfung ablegen müssen und dafür mehrere Anläufe brauchen. Diese Perspektive tröstet.
Definition von Erfolg verändern?
Angst vor einem Misserfolg plagt vor allem Menschen mit einem ohnehin geringen Selbstwertgefühl, und das stabil zu verbessern ist schwierig. Die Psychologin Carol Dweck, die lange in Stanford gelehrt hat, spricht von einem „Growth Mindset“ und sagt, dass nicht nur unser Talent über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, sondern unser Selbstbild. Das formt sich zeitig. Darum ist es gut, statt Kinder überschwänglich für anspruchsloses Tun zu loben, ihnen Mut zuzusprechen, sich anzustrengen und Dinge einzuüben. Denn so erleben sie, dass sie Fortschritte beeinflussen und vermeintliche Fehler als Lerngelegenheiten sehen können. Das wiederum befeuert den Glauben an ihren Erfolg und nicht daran, dass bei einem Misserfolg die Grenzen ihrer Kompetenz ausgeschöpft sind. Die eine Realität gibt es eben nicht, sie liegt im Auge des Betrachters.
In der positiven Psychologie wird das betont. Glück sei eine Einstellungssache des Gehirns, und wir könnten unsere Definition von Erfolg verändern, sagt der Wissenschaftler Shawn Achor, der in Harvard geforscht hat. Seine Theorie: Die äußeren Lebensumstände eines Menschen bestimmen nur zu zehn Prozent über das eigene Langzeitglück, ein Großteil hat nichts mit Erfolg zu tun. Achor ist überzeugt, dass beruflicher Erfolg nur zu 25 Prozent mit dem Intelligenzquotienten zu tun hat, der Rest ist Optimismus, sozialer Rückhalt, positives Stressmanagement.
Handfeste, wenig überraschende Empfehlungen, um das Wohlgefühl zu befördern, geben er und sein Team auch: Wesentliche Säulen seien Sport, Meditation und eine Haltung der Dankbarkeit. Das dürfte Wasser auf die Mühlen der selbstbewussten, gern trotzig auftretenden Erfolgsverweigerer sein, die ihre Anerkennung im Privaten suchen und betonen, dass Geld allein nicht glücklich mache. Marina Schall und Astrid Schütz, Psychologinnen an der Universität Bamberg, haben ein Buch darüber geschrieben: „Macht Erfolg glücklich? Wie Leistung belasten und zufrieden machen kann.“ Darin erklären sie unter anderem, „wie Überfluss unsere Genussfähigkeit verringert“.
Berufswechsel faszinieren, weil sie zeigen, was noch möglich ist
Topmanager können sich Überfluss leisten. Werden sie nach ihren größten Lebenserfolgen befragt, dann antworten sie aber gern: meine Kinder, meine Familie. Zurück bleibt die Frage: „Kaufen wir denen das wirklich ab, oder war das der Vorschlag der PR-Abteilung?“ Andererseits, wer kann das ernsthaft bewerten? Denn beim Thema, was das Beste für andere ist, reden Menschen gern mit. Besonders besorgte Eltern. Wäre doch schön, wenn die Tochter die Kanzlei, der Sohn die Apotheke übernehmen würde. Was aber, wenn die Tochter keinerlei Neigung zu Jura verspürt, der Sohn sich schon als Schüler schwer mit Chemie tat? Dann ist es ein Erfolg, frühzeitig zu kommunizieren, dass sich die Pläne nicht decken. Dann ist ein entschiedenes Nein ein Erfolg.
Manche gelangen erst in der zweiten Lebenshälfte an ihre Kraft, sich dem zu widmen, was sie tatsächlich erfüllt. Sie wechseln den Beruf. Geschichten über Unerschrockene, die sich zum Busfahrer umschulen lassen, weil der Bürojob sie nicht mehr erfüllt, die ein Café eröffnen, weil das nach der Pandemie wieder realistischer wird, solche Aufbrüche faszinieren, weil sie aufzeigen, was noch alles möglich ist. „Am Mute hängt der Erfolg“, nachzulesen in Theodor Fontanes Roman „Stine“. Erschienen 1890. Etwas aus sich zu machen bleibt eine lebenslange Aufgabe.
Ein Ende ist nicht in Sicht. Psychologe Walter sagt, dass sich natürlich auch Ältere Ziele setzen sollen. „Das Beste kommt zum Schluss. Ein Ehrenamt, Enkel erleben, auf den Eiffelturm.“ Was Erfolg bedeutet, ist abhängig von der Lebensphase. Auch hier lohnt ein kritischer Blick. Wer zum Beispiel früh als extrem erfolgreich gilt, etwa, weil er durch Herkunft oder Erbe zufällig komfortable Aufstiegschancen gehabt hat, dem begegnet häufig Misstrauen, innerlich wie äußerlich. Ist das wirklich erarbeitet, echt verdient? Das kann das Hochstaplersyndrom – hoffentlich merkt keiner, dass ich meiner Position nicht gewachsen bin – und Neid auslösen. Erfolg kann aufgrund zweier Faktoren einsam machen: weil die ganze Energie in die Arbeit fließt und das Privatleben leidet und weil Neider parat stehen.
Abrutschen in eine Erfolgsdepression
Sich am Erfolg zu erfreuen – zumal am Erfolg anderer –, scheint etwas für Fortgeschrittene zu sein. „Die Freude auszukosten, etwas geschafft zu haben, fällt vielen Menschen schwer“, beobachtet Jürgen Walter. Im Extremfall gibt es eine Erfolgsdepression, bei der man nach einem kurzen Hoch in ein Loch fällt. Absurd? Nicht, wenn man an eine bestandene Prüfung denkt. Nach der Paukerei ist es von heute auf morgen vorbei mit dem frühen Aufstehen. „Ich muss nicht mehr um sieben Uhr loslegen, lernen, lernen, kann mich daran aber nicht erfreuen, sondern falle in ein kleines Loch.“
Etwas ganz anderes zu tun kann da heraushelfen. Entscheidend sei, sich zu überlegen, wie man danach die Zeit nutze, sagt Walter und gibt zu bedenken. „Kaum eine Mannschaft hat eine Weltmeisterschaft nach vier Jahren wiederholt.“ Relevant findet der Psychologe die Fähigkeit, einen Zustand der Zufriedenheit zu erlangen. Das ist für ihn kein Widerspruch zu dem Antrieb, sich Ziele zu setzen. In seinen Kursen benutzt er gern das Bild vom Hund, der einen Ring um den Hals trägt mit einem Stock, an dem eine Wurst hängt: „Der kann so schnell rennen, wie er will, die Wurst wird er nie kriegen.
Er hat immer wieder das Gefühl, es könnte doch noch besser sein.“ Befördert wird dieses hektische Hinterherjagen durch die immensen Vergleichsmöglichkeiten in sozialen Medien und die absurden Inszenierungen dort. Für Jürgen Walter eine „Riesengefahr“. Naive, die ständig online sind, fühlen sich durch all die schönen, modisch gekleideten Menschen vor hübschen Kulissen in ihrem normalen Durchschnittsdasein abgehängt und erfolglos. „Mental starke Menschen machen ihr Glück nicht abhängig von anderen und geben ihnen nicht so viel Macht, sich gut oder schlecht zu fühlen.“
Älteren falle das leichter. Jürgen Walter gewinnt Abstand durch Humor. „Ich habe mal deutsche Meisterschaften im Tischtennis gespielt, im Dreierteam, wir sind Achter geworden. Wo steht denn, dass ich Erster sein muss? Ist der Zweite schon der erste Verlierer, dann können wir einpacken!“ Einmal hat er sich trotzdem geärgert, nämlich als er Marathon gelaufen ist, am Ende leicht übergewichtig und nicht mehr fit. „Mein Ziel: Ich wollte nicht als Letzter einlaufen, zweimal war hinter mir der Besenwagen.“ Beim 104-Kilometer-Lauf über drei Tage in Frankreich war er Viertletzter. Da hat er sich geärgert. „Die ersten und die letzten drei kriegten einen Pokal. Ich nicht.“