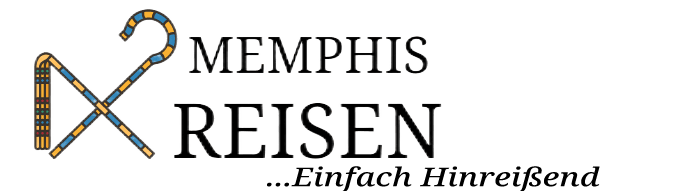Wachstumssorgen in Deutschland: Die FDP ruft nach der Wirtschaftswende


Die FDP kennt das. Die Wirtschaftsaussichten sind kläglich. Doch statt mutiger Reformen plätschert die Regierungsarbeit vor sich hin. Die Lage von heute erinnert an die frühen Achtzigerjahre. Damals, im Spätsommer 1982, legte ihr Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ein Konzept zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vor – das seinen Teil zum Bruch der sozialliberalen Koalition beisteuern sollte, weil Bundeskanzler Helmut Schmidt die dort verlangten Reformen weder seiner SPD noch dem Land zumuten wollte.
An diesem Wochenende hat FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai die Spekulationen um die Fliehkräfte im Ampelbündnis angeheizt, indem er wenig verklausuliert für eine Umorientierung warb. Eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP wäre nach seinen Worten in der Lage, die Probleme des Landes nicht nur richtig zu analysieren, sondern auch gemeinsame Lösungen zu finden.
Am Montag lud das von den Liberalen geführte Bundesfinanzministerium nach Berlin-Mitte in den sogenannten Maschinenraum. Das Thema der Veranstaltung lautete: Neue Dynamik – Wie gelingt die Wirtschaftswende? Zum Auftakt präsentiert Niklas Potrafke, Leiter des Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie am Ifo-Institut, die Ergebnisse einer internationalen Umfrage.
Es lohnt sich nachzuschlagen
Kurz gefasst war es ein ernüchterndes Zeugnis für den Investitionsstandort Deutschland. Stichworte der benannten Defizite sind: Bürokratie, Digitalisierung, Energie und Ressourcen, Fachkräftemangel. Dann kam für das Finanzministerium die Gelegenheit, seinen Aufschlag zu machen. „Wir brauchen eine Wirtschaftswende. Wir brauchen eine neue Dynamik. Wir haben ein Problem mit dem Standort“, sagt Florian Toncar, der Parlamentarischer Staatssekretär von Christian Lindner (beide FDP) ist.
SPD und den Grünen infrage zu stellen.
Damals gab es einen starken Rückgang der Auslandsnachfrage bei stagnierender oder sogar rückläufiger Binnennachfrage, eine Verschlechterung des Geschäftsklimas und der Zukunftserwartungen, eine Einschränkung der gewerblichen Produktion, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine Zunahme der Insolvenzen. Und heute? Da sieht es nicht viel besser aus.
Der „Marktgraf“ mahnt
Lambsdorff konstatierte nüchtern, die gesamte Weltwirtschaft befinde sich in einer Stabilisierungs- und Anpassungskrise. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, „dass ein wesentlicher Teil der Ursachen unserer binnenwirtschaftlichen Probleme auch im eigenen Lande zu suchen ist“. Eine liege zweifellos in der weitverbreiteten und eher noch wachsenden Skepsis im eigenen Land.
Robert Habeck (Grüne) beschreibt die Lage als „dramatisch schlecht“. Sein Parteifreund Lindner nennt die Wachstumsperspektive von 0,2 Prozent für dieses Jahr peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich.
Beide dürften sich schwer damit tun, folgende Aussagen zu unterschreiben, weil sie sich damit selbst ein schlechtes Zeugnis ausstellten, aber andere dürften damit wenig Probleme haben, im Gegenteil. So heißt es bei Lambsdorff: Es seien zwar wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen worden. Bisher sei es jedoch dadurch nicht gelungen, die pessimistische Grundstimmung zu überwinden. „Die bisherigen Beschlüsse sind in der Wirtschaft vielfach als zu kurzatmig, zu vordergründig, zu unsystematisch und teilweise sogar als in sich widersprüchlich angesehen worden.“
Wenn der „Marktgraf“ seinerzeit mahnt: „Wachsende Arbeitslosigkeit, unkontrollierbare Eskalation der Haushaltsprobleme und mangelnde Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme können aber leicht den Boden für eine politische Systemkrise bereiten“, dann mag heute der ein oder andere an die AfD denken, die inzwischen für jeden Fünften im Land als wählbar gilt.
Was sollte man tun?
Wenig gibt Lambsdorff auf Überlegungen, die nun von Grünenpolitikern und Sozialdemokraten vorgetragen werden, mit neuen Schulden die Wirtschaft zu stützen. „Auch die derzeit wieder verstärkt zu hörende Forderung nach einer Politik der forcierten staatlichen Nachfragestützung durch zusätzliche mehrjährige kreditfinanzierte öffentliche Ausgabenprogramme verkennt, dass dadurch allein (schon wegen der damit verbundenen Folgekosten) die strukturellen Probleme in den öffentlichen Haushalten eher noch vergrößert würden“, heißt es in seinem Papier.
Der Nachfrageeffekt dürfte angesichts der pessimistischen Grundstimmung weitgehend verpuffen. Zudem machten die öffentlichen Investitionen nur 16 Prozent der gesamten Anlageinvestitionen aus.
Aber was sollte man tun? Viel, wozu der Graf rät, kommt in der aktuellen Debatte vor: mehr Infrastrukturmaßnahmen im Umweltschutz, Beseitigung von Engpässen im Straßenbau, zusätzliches Geld für die Bahn. Außerdem: Vermeidung eines Anstiegs der gesamtwirtschaftlichen Steuerlastquote.
Oder mit Blick auf die Sozialhilfe (heute Bürgergeld): mehrjährige Minderanpassung (gegenüber derzeitigem Verfahren) beziehungsweise zeitweiliges Einfrieren der Regelsätze; oder Überprüfung des für die Bemessung der Regelsätze relevanten Warenkorbs. Und nicht zu vergessen: strengere Regeln, was Hilfesuchenden an Arbeit zugemutet werden kann.
Lambsdorff besaß offenkundig Weitblick. Abschließend warnt er in seinem Konzept: „Die Konsequenz eines Festklammerns an heute nicht mehr finanzierbare Leistungen des Staates bedeutet nur die weitere Verschärfung der Wachstums- und Beschäftigungsprobleme sowie eine Eskalation in den Umverteilungsstaat, der Leistung und Eigenvorsorge zunehmend bestraft und das Anspruchsdenken weiter fordert – und an dessen Ende die Krise des politischen Systems steht.“ Da ist fast alles gesagt. Allerdings könnte man jetzt ergänzen: Erstes Opfer dürften seine Parteifreunde sein, die heute mitregieren – noch.