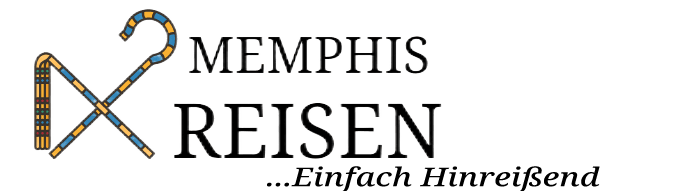Christdemokraten: Merkel meinen, ohne Merkel zu sagen


Es ist 19.28 Uhr am Mittwochabend, als Friedrich Merz das M-Wort sagt. Es wird das einzige Mal an diesem Abend im Congress Centrum in Hannover sein, dass der CDU-Vorsitzende den Namen der früheren Bundeskanzlerin ausspricht. Es wird überhaupt das einzige Mal sein, dass ihr Name hörbar genannt wird in den zweieinhalb Stunden, in denen sich die CDU-Spitze in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit ihren Gästen über das neue Grundsatzprogramm der Partei austauscht. Das soll auf dem Parteitag Anfang Mai verabschiedet werden.
Merz bettet den Namen seiner – zumindest ehemaligen – politischen Feindin gut ein, er erwähnt ihn nur beiläufig. Immerhin kann niemand sagen, er habe ihn nicht ausgesprochen. Die rhetorische Konstruktion, die er wählt, ist nicht ungewöhnlich. Merz erinnert an die Rede des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Olaf Scholz am Sonntag nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Um die Fallhöhe für den Mann, dessen Amt Merz fest im Auge hat, zu vergrößern, hebt er Scholz auf ein Podest. Der Kanzler habe an jenem 27. Februar 2022 „eine unglaublich bewegende, gute, international wahrgenommene Regierungserklärung“ gehalten. Eine Regierungserklärung des „Bundeskanzlers der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt und des größten Landes der Europäischen Union“. So, dass müsste reichen als Sockel.
Merz springt zwei Jahre nach vorne, ins Jetzt. Er erinnert an das Treffen von Scholz und zahlreichen anderen Staats- und Regierungschefs mit dem französischen Präsidenten dieser Tage in Paris, bei dem es Streit über den Vorschlag Macrons zum Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine gegeben hatte. Der CDU-Chef bemängelt den fehlenden Schulterschluss zwischen Berlin und Paris. „Die Zeitungen sind voll von der Beschreibung eines vollkommenen Zerwürfnisses zwischen Deutschland und Frankreich.“ Er beschreibt einen Kanzler, der „sitzt und schweigt“ und nach Hause zurückkehrt und in einem Interview erkläre, was er mit „diesen Taurus-Raketen wirklich meint“.
Dann ist es so weit. „Können Sie sich vorstellen, dass das ein Konrad Adenauer, ein Helmut Kohl, eine Angela Merkel, ja können Sie sich vorstellen, dass selbst ein Helmut Schmidt, ein Willy Brandt, selbst Gerhard Schröder…“, der Satz bleibt unvollendet. „Alle hätten das anders gemacht.“ Es ist geschafft. Merz hat Merkel gesagt.
CDU versammelten Mitglieder Merkel und die 16 Jahre Kanzlerschaft, die sie ihren aufs Regieren so versessenen Parteifreunden verschafft hat, behandeln wie den sprichwörtlichen Elefanten im Raum. Billigt Merz ihr noch zu, mit Frankreich besser umgegangen zu sein als Scholz, so lassen die Diskussionsteilnehmer und Fragesteller die Jahre 2005 bis 2016 weitgehend außen vor. Als wüssten sie nicht recht, wie sie damit umgehen sollten, dass es einerseits Jahre der Macht mit vielen bewältigten internationalen Krisen waren, andererseits seit zwei Jahren offenbar wird, was alles auf der Strecke geblieben ist: die Bundeswehr, die Energiewende, die Infrastruktur, um nur einige Punkte zu nennen. Bloß die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien erwähnt, ohne das zu vertiefen, dass es „vielleicht“ die „ein oder andere Leerstelle“ gegeben habe.
Merz spricht im Zusammenhang mit dem Grundsatzprogramm und dem Weg dorthin von einem „Stück Selbstvergewisserung, Aufarbeitung und Kritik“. Was die CDU in den ersten beiden Jahrzehnten des Jahrhunderts versäumt hat bei der Stärkung der militärischen Fähigkeiten, der Unabhängigkeit von vor allem russischen Rohstoffen oder von chinesischen Hightech-Produkten thematisiert er, der so gerne Deutlichkeit einfordert, nicht.
Erst ganz zum Ende spricht ein Pastor aus dem Publikum seine Parteifreunde und Merz auf das an, was viele in der CDU als Defizit der Merkel-Jahre ansehen. Der Name der Kanzlerin fällt allerdings auch an dieser Stelle der Veranstaltung nicht. Man habe es lange mit der asymmetrischen Demobilisierung versucht, weist er auf die von Merkel angewandte Strategie hin, durch das Vermeiden von Kontroversen die Anhänger des politischen Konkurrenten so einzuschläfern, dass diese nicht zur Wahl gehen, was die eigenen Siegchancen erhöht. Es sei richtig auszugleichen, sagt der Pfarrer, der zugleich warnt, dass einmal verloren gegangenes Vertrauen schwer zurückzugewinnen sei. Aber beim Moderieren sei es oft so, dass der „größte Schreihals“ die Richtung vorgibt. Ob er damit die AfD meint, lässt er offen. Von Merz will er wissen, wie er das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen gedenke, so dass diese überzeugt seien, aus dem Grundsatzprogramm werde wirklich neue Politik.
Ein Ende der Chloroformierung des Gegners
Merz nimmt den Ball auf. Schon bis dahin hat er die Ampelkoalition und Kanzler Scholz nicht geschont, hat betont, dass die Union bereit sei, in den Wahlkampf zu gehen und anschließend das Land zu regieren. Dazu müsse man konkret sagen, was man machen wolle, wenn man wieder regiere. „Ich plädiere sehr dafür, dass wir die politische Auseinandersetzung mit der Regierung und den sie tragenden Parteien auch suchen und ihr nicht aus dem Wege gehen“, wie das mit der asymmetrische Demobilisierung gemacht worden sei. In Erinnerung an den früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sagt Merz unter dem Gelächter, dieser habe von der „Chloroformierung des politischen Gegners“ gesprochen.
Er halte davon „relativ wenig“, fährt Merz fort, weil es „am Ende des Tages die Demokratie beschädigt“, wenn man der politischen Auseinandersetzung „in der Mitte unseres Landes“ aus dem Wege gehe. Unterschiede müssten deutlich gemacht werden. Den Unterschied zwischen der Methode Merkel und der Methode Merz macht er damit zwar nicht übermäßig, aber doch hinlänglich klar, auch ohne den Namen der Kanzlerin ein weiteres Mal zu erwähnen. Sein Publikum scheint es zu verstehen. Der Beifall für Merz ist groß.