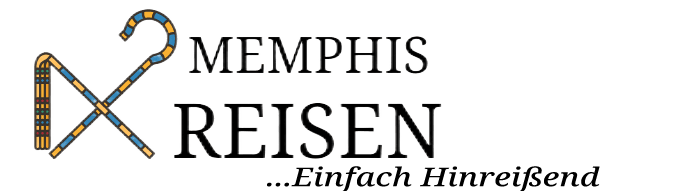Ein ganz normaler Mann unter Rechten in Ostdeutschland
Manchmal fühlt Herr Schulze sich fremd im eigenen Land. Er hat das Gefühl, nicht laut sagen zu dürfen, was er denkt. Man könnte ihn einen besorgten Bürger nennen, weil er Angst hat, seine Heimat zu verlieren. Aber es geht ihm nicht um Migranten und Muslime und solche Sachen. Was Schulze sorgt, das sind die Rechten.
In letzter Zeit sieht Schulze in der Nachbarschaft immer wieder zwei Jugendliche, die rasierte Schädel haben und Springerstiefel tragen. So wie die Neonazis in den Neunzigerjahren. Schulze hat den Eindruck, dass sich die Rechtsextremen inzwischen nicht mehr verstecken müssen. Zumindest nicht dort, wo er herkommt. Für ihn hat das viel mit dem Aufstieg der AfD zu tun, die hier bei der Europawahl stärkste Kraft geworden ist, so wie in ganz Ostdeutschland.
Schulze ist Sachse. Ansonsten ist er einer wie alle, ein Familienvater, Fußballspieler, Kleinwagenfahrer, Wohnungsmieter, Brillenträger, Universitätsangestellter, Theologe. Aber keiner von den Theologen, die den Lauf der Welt am liebsten anhalten würden. Auch keiner von der Sorte, für die Wörter wie „Grenzschutz“ des Teufels sind. Wäre Deutschland ein Kreis und müsste man darin für Schulze den passenden Ort finden, er wäre in der Mitte gut aufgehoben. Die Menschen um ihn herum sind in den vergangenen Jahren aber weitergezogen, und in der Mitte fühlt sich Schulze inzwischen ziemlich einsam. Davon möchte er berichten. Aber nicht unter seinem echten Namen, das ist ihm zu heikel. Deshalb einfach: Schulze.
Glatzköpfe kennt Schulze aus seiner Schulzeit
Schulze ist ein Nachwendekind, gerade dreißig geworden. Um sich an den Anfang der Neunzigerjahre, die Baseballschlägerjahre, zu erinnern, ist er zu jung. Aber Glatzköpfe kennt er auch aus seiner Schulzeit in den Nullerjahren. Er wuchs als Sohn zweier Lehrer in einem gutbürgerlichen Stadtteil von Dresden auf, alles sehr behütet. Trotzdem gab es da Skinheads. In der Mittelschule, an der seine Mutter unterrichtete, fragten sie, ob sie mal raus dürften, sie müssten sich die Springerstiefel schnüren. Seine Mutter, erzählt Schulze, habe das an den Rand der Depression gebracht. Vor seiner eigenen Schule lungerten sie ebenfalls herum, pöbelten, warfen Flaschen. Sein Cousin war ein Punk, mit Skateboard und bunten Haaren. Des Öfteren musste er wegrennen. Schulze ist so etwas nicht passiert. Er hielt die Klappe und hatte seine Ruhe.
Über die Jahre, so hat Schulze es wahrgenommen, verschwanden die Rechtsextremen von den Straßen. Jetzt sind sie wieder da. Seine Frau war neulich mit dem zweijährigen Sohn beim Kinderarzt. Mit ihr im Wartezimmer saß ein Vater, der trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Alles hat ’nen Haken, nur das Kreuz hat vier.“ Schulze selbst stand vor einiger Zeit an der Straßenbahnhaltestelle, als ihm das Shirt eines Mannes auffiel. Darauf waren zwei Symbole zu sehen, die zusammen ein Hakenkreuz ergaben, und dazu geschrieben: „Zum Basteln“. Als Schulze bei sich zu Hause seinen dreißigsten Geburtstag feierte, parkte unten vor der Haustür ein riesiger, brauner Pick-up, auf der Heckklappe ein Aufkleber: „Braun statt bunt“. Seine Gäste fragten Schulze, wo er denn hier wohne.
Schulze wohnt in Leipzig. Von Dresden zog er zum Studium nach Halle an der Saale und nach Göttingen, inzwischen ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter. In Leipzig lebt er aber nicht im Süden mit seinen Gründerzeithäusern und Studentenkneipen, wo es die meisten seiner Kollegen von der Uni hinzieht und der eher für Linke bekannt ist. Als seine Frau und er eine bezahlbare Wohnung für die Familie suchten, landeten sie im Norden. Gohlis-Nord heißt die Gegend, nicht weit dahinter beginnen die Felder. Jetzt bei der Europawahl stimmten in Schulzes Wahlbezirk 34 Prozent für die AfD, 15 für das Bündnis Sahra Wagenknecht und elf für die CDU. Fast sechzig Prozent gingen gar nicht erst zur Wahl.
Manchmal sieht er Rechtsextreme mit Kampfhunden
Die Schulzes wohnen in der Krochsiedlung. Das ist eine Ansammlung riesiger Wohnblocks im Bauhausstil, mit viel Grün dazwischen, aber sichtlich in die Jahre gekommen. Benannt ist die Siedlung nach ihrem jüdischen Finanzier Hans Kroch. Der entkam gerade so den Nationalsozialisten, seine Frau wurde im KZ Ravensbrück ermordet. Auf den Häusern, die seinen Namen tragen, findet man nun Sprühereien mit dem Schriftzug „Lok Leipzig“, für Lokomotive Leipzig. Das ist ein Fußballverein, der für seine rechtsextremen Fans berüchtigt ist. Direkt neben den Krochhäusern stehen die Plattenbauten aus DDR-Zeiten, wo Schulze manchmal Rechtsextreme mit frei laufenden Kampfhunden sieht und lieber nicht mit seinem Sohn entlanggeht.


Schulze ist wichtig zu betonen, dass die Rechtsextremen nicht an allen Ecken auftauchen. Schließlich leben hier auch viele Migranten und Alte und Durchschnittsleute. Aber sie tauchen eben wieder auf, so wie die zwei Jugendlichen mit den Springerstiefeln, und das hat in Schulzes Augen etwas mit den Durchschnittsleuten zu tun. Die Rechtsextremen trauten sich nämlich wieder in die Öffentlichkeit, weil sie sich wieder trauen könnten. „Das wird nicht geächtet.“
Das macht Schulze nicht nur an den Wahlergebnissen fest, sondern an vielen kleinen Beobachtungen. Zum Beispiel liegt in seiner Gegend das rechtsextreme Magazin „Compact“ inzwischen wie selbstverständlich beim Discounter im Zeitschriftenregal. Neulich machte Schulze mit der Familie einen Sonntagsausflug zu einem Schloss, da stand an der Straße ein Mann und schwenkte die schwarz-weiß-rote Reichsflagge. Von den Vorbeifahrenden hätten viele gehupt und gewunken, erzählt Schulze. Zu schaffen macht ihm auch der gehässige Ton, den er jetzt überall hört. Im Supermarkt zum Beispiel, wenn die Kassiererin die Kunden in ein Gespräch verwickelt, das darauf hinausläuft, dass alle Politiker Verbrecher sind.
Ein Ort, an dem Schulze mit Rechtsextremen wie mit Durchschnittsleuten zu tun hat, ist der Fußballplatz. Er spielt in einer Amateurklasse. Da gibt es besonders linke und besonders rechte Teams und auch normale Teams wie das von Schulze. Wobei normal laut Schulze auch heißt: Wenn es gegen Linke geht, sagen sie in seinem Verein: „Die schießen wir aus der Liga!“, und wenn es gegen Rechte geht, sagen sie, das seien doch nur Lausbuben. Je nachdem, gegen wen sie spielen, stehen am Spielfeldrand aber auch mal Männer, die eine Schwarze Sonne auf den Nacken tätowiert haben. Das ist ein Symbol, das in etwa so aussieht, als hätte man drei Hakenkreuze übereinandergelegt.
Oft schweigt Schulze einfach
In Schulzes Mannschaft spielen ein Kameruner und ein Afghane. Von den gegnerischen Spielern und Fans werden sie oft beleidigt. Manchmal ist Schulze nicht sicher, ob sie die zwei wieder sicher vom Spielfeld bringen können. Auch im eigenen Verein hört Schulze Dinge, die ihn stören. Wenn sie nach einem Spiel beim Bier zusammenstünden, sage schon mal einer abfällig, für Merkel seien die Ausländer ja alles wertvolle Arbeitskräfte. Schulze schweigt dann meistens. „Wenn ich etwas sage, wird das abgeblockt, ich bin dann ein Jasager, einer von denen da oben.“ Dabei fühlt er sich seinen Fußballleuten in vielem gar nicht fremd. Er spreche deren Soziolekt, sagt Schulze. „Aber trotzdem verliere ich das Gefühl, wie man überhaupt noch miteinander reden kann, ohne die Gräben weiter zu vertiefen.“
Es gibt viele Situationen, in denen Schulze seine Meinung lieber für sich behält. Wenn er auf offensichtlich Rechtsextreme trifft, macht er es so wie früher in Dresden. Er will ja nicht aufs Maul bekommen. Auch in der Familie schweigt Schulze manchmal. Da gibt es einen schwierigen Onkel, der ist Arzt und sagt, dass man sich bewaffnen müsse, wenn jetzt so viele Migranten kommen. Vor seinen Nachbarn wiederum würde Schulze sich nicht als jemand zu erkennen geben, der findet, die Politik mache angesichts der heftigen Krisen gerade einen ganz guten Job. Auch, dass er zuletzt die Grünen gewählt hat, würde Schulze nicht überall erzählen. Dass es zu viele Ausländer gebe, könne man gefahrlos behaupten, aber als Grünenwähler sei man abgeschrieben.


Ein überzeugter Grüner ist Schulze dabei gar nicht. Lange schwankte er zwischen CDU und SPD. Schulze diskutiert darüber viel mit seinem Vater. Der ist ein Supergrüner, der gern erzählt, dass er ein Auto mit einem Verbrauch fährt, der unterhalb der Laborwerte liegt. Schulze nervt das „arrogante Auftreten der grünen Fundis“. So könne man nicht reden, wenn man die Leute auf dem Fußballplatz erreichen wolle. Schulze wählt die Grünen vor allem aus Protest oder besser: aus Protest gegen den Protest. Er sagt: „Das sind die Einzigen, die auf die rechten Narrative nicht reinfallen, die da stabil stehen.“
Was dagegen die CDU in Sachsen macht, verstört Schulze manchmal. In Leipzig warb die Partei mit Plakaten, auf denen stand „Machen statt Gendern“. Der Kampf gegen das Gendern ist für Schulze so ein Beispiel, wie die anderen Parteien der AfD hinterherrennen. Die CDU mache den Unfug mit, dabei werde das Thema nur aufgebauscht. Bei ihm an der Uni zum Beispiel interessiere das niemanden, abgesehen vielleicht von ein paar aktivistischen Studenten. Mal gendere er in seinen Mails, mal nicht. Beschwert habe sich noch keiner.
Die Frage, warum die Erzählungen der AfD in seinem Umfeld so gut verfangen, beschäftigt Schulze. An die weit verbreitete Erklärung, dass es an den Brüchen in den Biographien der Ostdeutschen liege, mag er nicht glauben. Den Menschen gehe es doch besser als früher. Neulich zum Beispiel war er auf einer Hochzeit im Erzgebirge, lauter gut situierte Leute. Trotzdem musste der Brautvater in seiner Rede darauf hinweisen, dass ihm alles zu woke geworden ist. Bei 36 Geschlechtern, die es inzwischen gebe, sei es doch schön, dass sich eine ordentliche Frau und ein ordentlicher Mann gefunden hätten, sagte er.
Den Leuten, glaubt Schulze, fehlt eine Erzählung
Schulze leuchtet eine andere Erklärung für den Unmut mehr ein. Er ist da kein Fachmann, aber er macht sich seine Gedanken. Den Leuten, glaubt er, fehle so etwas wie eine verbindende Erzählung. Verfassungspatriotismus ziehe offenbar nicht, und auch die Kirche kriege es nicht hin. Was Schulze genau meint, erklärt er mit einem Schlachtruf. Bekannt gemacht haben den die Ultras von Dynamo Dresden. Im K-Block, wo Schulze schon viele Hitlergrüße gesehen hat, brüllen sie zu Tausenden: „Ost-, Ost-, Ostdeutschland!“
Inzwischen machen sie das auch anderswo. Neulich war Schulze als Zuschauer bei einem Darts-Turnier. Es wurde viel getrunken und irgendwann „Ostdeutschland“ gerufen. Schulze hat bei solchen Gelegenheiten auch schon mitgebrüllt, er ist da nicht so. Langsam glaubt er aber, dass der Ruf ein Gefühl ausdrückt, das die AfD bedient. „Die Menschen suchen verzweifelt ein Identitätsangebot und rennen denen hinterher, die am einfachsten sprechen“, sagt er. Manche seiner Fußballleute zum Beispiel: „Die begreifen gar nicht, dass sie auf Rattenfänger reinfallen.“
Früher fand Schulze Wahlkampfzeiten schön. Gelebte Demokratie. Jetzt, rund um die Europawahl am vergangenen Sonntag und wenige Monate vor drei Landtagswahlen im Osten, fühlt er vor allem Unbehagen. Er fürchtet, dass die Demokratie kaputtgeht. Manchmal verteidigt er sie mit Aufklebern. Das Hakenkreuz, das jemand mit Edding in den Hausflur geschmiert hat, überklebte er mit Blümchen. In der Nachbarschaft brachte er ein paar „No AfD“-Sticker an Laternenmasten und Stromkästen an, die seine Schwägerin im Internet bestellt hat. Bis auf einen wurden alle in wenigen Tagen abgeknibbelt.


Schulze denkt oft, er müsse mehr tun. Weil das mangelnde Gemeinschaftsgefühl ja auch daher komme, dass sich die Leute nicht mehr engagierten. Er saß schon über Mitgliederanträgen von SPD, CDU und Grünen, unterschrieben hat er aber keinen. Von keiner Partei fühlt er sich so ganz vertreten. Vielleicht, denkt Schulze, muss er sich damit abfinden und einfach in eine eintreten. Aber er hat auch Angst, Gesicht zu zeigen, weil er nicht weiß, was ihm dann passiert.
Wenn er seine Doktorarbeit fertig hat und irgendwann als Pfarrer arbeitet, wird Schulze das tun müssen. Die evangelische Kirche warnt inzwischen offiziell vor der AfD. Politik und Kirche lassen sich für Schulze schwer trennen. In einer Kirchengemeinde muss ein Pfarrer Position beziehen, etwa wenn es um die Flüchtlingshilfe geht. Schulze will sich nicht wegducken, sagt aber: „Scheitern ist nicht ausgeschlossen.“ Er kennt einen Pfarrer, der zwölf Jahre lang in einer Gemeinde im Erzgebirge war, bestens gelitten. Bis er sich weigerte, einen Aufruf zu unterschreiben, wonach Homosexuelle ungeeignet für das Pfarramt seien. Die Stimmung wurde so giftig, dass er die Gemeinde verlassen musste.
Schulze ist nicht sicher, ob er das aushält. Mit seiner Frau überlegt er deshalb, in welche Landeskirche er nach der Promotion gehen soll. Zum Studium war er in Göttingen, Niedersachsen ist schön. Schulze sagt: „Wir müssen uns entscheiden, was wichtiger ist: die Nähe zur Familie oder ein stabiles politisches Umfeld.“