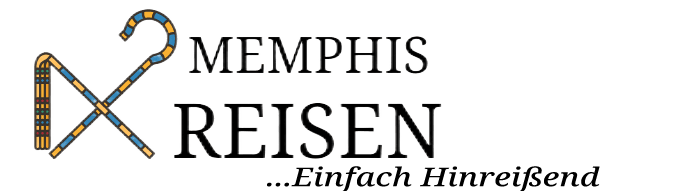El Salvador: Das Ende des Bandenterrors
In El Salvador kann jeder von Gräueltaten der Banden berichten. La Campanera, eine Siedlung am Rande der Industrievorstadt Soyapango, war lange eines der gefürchtetsten Viertel des Landes. Marta Mejia Sousa ist hier seit fast zwanzig Jahren Direktorin der örtlichen Schule.
„Als ich hier anfing, war die Situation sehr kritisch“, erzählt sie. „Ohne die Einwilligung der Jungs kam hier keiner rein. Er herrschte eine totale Kontrolle, eine ständige Angst.“ Auch die Schule musste mit ihnen zusammenleben. Viele stießen schon im Schulalter zu den Gangs. „Sie gingen hier ein und aus, einige bewaffnet“, sagt die Direktorin. Und sie machten und nahmen sich, was sie wollten.
Einer der bedrückendsten Vorfälle betraf eine der Schülerinnen ihrer Schule. Das damals 15 Jahre alte Mädchen wurde als Geburtstagsgeschenk für einen der Anführer ausgewählt. Diese „Ehre“ bedeutet nichts weniger als die Verurteilung zur Gruppenvergewaltigung durch Gangmitglieder. Im Fall des Mädchens waren es zwölf.
Dem Opfer bleibt in solchen Fällen nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Denn die Bande droht, der Familie Gewalt anzutun, sollte es sich widersetzen. Aus Angst vor Vergeltung traut sich niemand über solche Vorfälle zu sprechen. Die Direktorin fand es dennoch heraus. Aber auch ihr waren die Hände gebunden. Hätte sie versucht, etwas gegen die Täter zu unternehmen, wäre das ihr Todesurteil gewesen. „Es ist schwierig. Man schweigt. Man fühlt sich als Komplizin der Banden“, sagt die Direktorin.
Mara Salvatrucha (MS-13), machten die vom Staat verlassenen Armenviertel zu ihrem Herrschaftsgebiet. Die schlimmen Zustände dort boten den Banden ideale Bedingungen, um ihren Einfluss immer auszudehnen.
Auf dem Platz vor der Schule am unteren Ende der Hauptstraße von La Campanera hingen früher gerne die „Homeboys“ von Barrio 18 herum. Heute ist der Platz die Endstation der Busse, die nach La Campanera fahren. Die Busfahrer zählten lange zu den bevorzugten Opfern der Banden. Jeden Abend mussten sie einen Teil der Tageseinnahmen abgeben. Wer sich weigerte oder das Geld nicht hatte, dem drohte Schlimmes. Er habe viele Kameraden verloren, sagt José Samuel, der seit dreißig Jahren als Busfahrer arbeitet. Gerade macht er zusammen mit Kollegen im Schatten eines kleinen Kiosks Pause. Unzählige Male habe er schon eine Waffe am Kopf gehabt, sagt Samuel. „Hier war sogar Busfahrer ein gefährlicher Job.“
Alle in La Campanera sprechen in der Vergangenheit, wenn es um die Banden geht, die Maras. Denn sie sind aus dem Alltag verschwunden. Präsident Nayib Bukele, der in der vergangenen Woche mit haushoher Mehrheit wiedergewählt wurde, hat sein Versprechen wahr gemacht, zumindest eines davon. Bukele war vor fünf Jahren durch den Verdruss der Salvadorianer über die alten Parteien an die Macht gekommen und hatte den Maras den Kampf angesagt. Zunächst soll die Regierung einen Pakt mit inhaftierten Bandenführern eingegangen sein, um die Mordrate zu senken. Doch dieser hielt nicht lange.
El Salvadors hinaus Aufmerksamkeit erregt. Sein Erfolg im Kampf gegen die Bandengewalt wurde in der gesamten Region wahrgenommen. Viele Länder Lateinamerikas bekommen die ausufernde Gewalt seit Jahren nicht in den Griff. Vor allem in Ecuador und Chile, wo das organisierte Verbrechen und die Gewalt in den vergangenen Jahren zugenommen haben, rufen Teile der Bevölkerung nach Politikern wie Bukele.
Soweit die Erfolgsgeschichte von Nayib Bukele und seinem Krieg gegen die Banden. Doch das ist nur die halbe Geschichte. Der andere Teil beginnt keine zwei Kilometer von Bukeles gigantischem Gefängnis entfernt in einer kleinen Siedlung namens El Milagre 77. Hier haben einige ehemalige Kämpfer nach dem Bürgerkrieg ein bisschen Land erhalten, von dem sie leben. Einer von ihnen ist der 47 Jahre alte Wilfredo Escobar Portillo, Vater von vier Kindern. Nur einer seiner Söhne wohnt noch zu Hause, der 19 Jahre alte Alexis. Er ist die Stütze der Familie, seitdem sein Vater schwer erkrankt ist und an der Dialyse hängt.


Soldaten in einem Wahlbüro in La Campanera bei der Präsidentenwahl am Sonntag
:
Bild: AFP
Doch seit fast einem Jahr müssen Escobar und seine Frau María Norma auf ihren Sohn verzichten. Alexis wurde am 15. März 2023 festgenommen. Er ging an diesem Tag zur Arbeit, zu seiner Bienenzucht, und auf die Baustelle, auf der er einen Job bekommen hatte. Am Abend standen Soldaten vor dem Haus. Zuerst hätten sie gedacht, es ginge um seine Bewerbung bei der Armee, erzählt Wilfredo Escobar im Schatten des Mangobaums im Hinterhof des einfachen Häuschens.
Doch die Soldaten kamen, um ihnen mitzuteilen, dass Alexis unter dem Verdacht, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, festgenommen worden sei. „Sie haben nichts gegen Alexis in der Hand, denn da gibt es nichts“, sagt dessen Vater. Hier in der Gemeinde gebe es schon lange keine Bandenmitglieder mehr. Doch es brauche nun keinen Grund mehr, um verhaftet zu werden. „‚Das Regime‘, sagten sie nur. Das berühmte Regime.“
Alexis ist kein Einzelfall in der kleinen Gemeinde. Auch andere junge Männer wurden willkürlich festgenommen. Landesweit sind es Tausende. Von den über 75.000 mutmaßlichen Bandenmitgliedern, die im Rahmen des Ausnahmeregimes festgenommen wurden, wurden bisher 7.000 wieder freigelassen, weil sie sich als unschuldig herausstellten. Mehrere Tausend dürften weiterhin unschuldig hinter Gittern sitzen. Ob und wann sie freikommen, steht in den Sternen.
An Präsident Bukele prallt jede Kritik an willkürlichen Festnahmen ab. „Sie sagen, dass wir die Menschenrechte verletzen. Wessen Menschenrechte? Wir stellen die Menschenrechte der ehrlichen Leute über jene der Verbrecher. Das ist das Einzige, was wir machen“, sagte er nach seinem Wahlsieg am Sonntag in der Hauptstadt San Salvador. Das Volk habe gesprochen, und es wolle diesen Weg weitergehen, so der 42 Jahre alte Bukele. Wer den Präsidenten öffentlich kritisiert, macht sich den Justizapparat zum Feind, den er im wachsenden Maße kontrolliert
Escobar und seine Frau hatten seit der Festnahme keinen direkten Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Besuche sind nicht gestattet und juristische Hilfe bekommen sie nicht. Das Einzige, was sie tun können, sind Pakete mit Essen und Hygieneartikeln im Gefängnis zu hinterlegen. Sie wenden all ihre Einkünfte dafür auf. „Doch wir wissen nicht, wie es ihm geht, was ihm vorgeworfen wird oder ob es eine Ermittlung oder einen Prozess gibt. Nichts. Es ist wie eine Entführung“, sagt Escobar. Selbst wenn sie sich einen Anwalt leisten könnten, dürfte der nicht zu Alexis. Der Ausnahmezustand erlaubt es, die Gefangenen ohne Prozess bis zu zwei Jahre festzuhalten. Diese Frist soll nun auf vier Jahre verlängert werden. Auch Massenprozesse wurden eingeführt.
Die Eltern von Alexis fürchten, dass sie ihren Sohn nie wieder sehen. María Norma holt ein Bild ihres Sohnes hervor. Ihr laufen die Tränen über die Wangen. Er habe nichts gegen den Kampf gegen die Banden, sagt Wilfredo Escobar. Doch er dürfe sich nicht gegen Unschuldige richten, die arbeiteten und studierten.