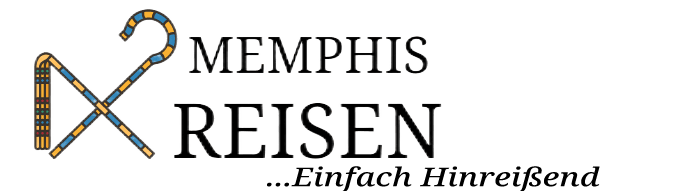Israel: Familien der Geiseln sprechen nicht mehr mit einer Stimme
Auch Zvika Mor hat einen Verwandten, der im Gazastreifen festgehalten wird – sein Sohn Eitan. Auch er hat schon demonstriert: Gemeinsam mit rechten Aktivisten hat er versucht, die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu blockieren. Mor sagt, nur militärischer Druck führe zum Sieg über die Hamas – und im besten Falle zur Rückkehr Eitans. „Es gibt nur einen Weg: Wir müssen den Krieg fortsetzen bis zum Sieg.“
Was Israels Geiselfamilien eint, ist der Schmerz. Und – in den Fällen derjenigen, deren Angehörige noch am Leben sein könnten – die Hoffnung. Davon abgesehen spiegeln auch die Geiselfamilien die Vielfalt der israelischen Gesellschaft wider: Sie haben unterschiedliche religiöse und ideologische Hintergründe – und vertreten zum Teil konträre politische Positionen.
Es gibt „radikale Linke“ und Besatzungsgegner unter ihnen, Anhänger von Netanjahus rechter Likud-Partei und religiös-zionistische Siedler. Das hat zu Konflikten geführt – und dazu, dass sich im Laufe der Zeit mehrere Gruppen von der Hauptorganisation „Forum der Familien der Geiseln und Vermissten“ abgespalten haben.
Das Warten hat viele der Angehörigen mürbe gemacht
Etwa 250 lebende und tote Menschen wurden am 7. Oktober vergangenen Jahres in den Gazastreifen verschleppt – Frauen, Männer, Babys, Teenager und Senioren. 116 sind im Rahmen der ersten Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas im November ausgetauscht worden, wurden von der Hamas freigelassen oder von der Armee befreit; zudem wurden 24 Leichen zurückgebracht.
115 Entführte befinden sich laut israelischen Angaben immer noch in Gaza. 41 von ihnen hat die Armee für tot erklärt, aber in vielen weiteren Fällen ist einfach nichts bekannt über das Schicksal – etwa bei Ofer Kalderon. Seine Familie habe zuletzt im November ein Lebenszeichen von ihm bekommen, sagt seine Cousine Yifat Kalderon.
Auf der wöchentlichen Demonstration auf dem „Geiselplatz“ vor dem Tel Aviver Kunstmuseum sprach am vergangenen Samstagabend auch ein Verwandter von Avera Mengistu. Der äthiopischstämmige Israeli ist eine der vier Geiseln, die schon vor dem 7. Oktober im Gazastreifen festgehalten wurden – in seinem Fall seit 2014. Es sei „unvorstellbar“ für ihn, die Geschichten der freigelassenen Geiseln zu hören und sich auszumalen, was Avera alles durchgemacht habe, sagte sein Verwandter Gil vor der Menge. Avera sei „nicht seit einen Monat dort oder seit einem Jahr, sondern seit zehn Jahren“.


Das Warten hat viele der Angehörigen mürbe gemacht und manche an den Rand der Verzweiflung getrieben. Zur Ungewissheit kommt der Psychoterror, etwa in Form der verstörenden Videos von Geiseln, die die Hamas veröffentlicht hat. Oder in Form von Nachrichten wie derjenigen vom Montagabend: Ein Hamas-Sprecher teilte mit, dass in zwei getrennten Vorfällen Wächter das Feuer auf israelische Geiseln eröffnet hätten.
Eine männliche Geisel sei dabei getötet worden, zwei weibliche verwundet. Namen nannte er nicht. Die israelische Armee teilte mit, sie habe bislang keine eigenen Erkenntnisse über den Vorfall.
Hoffnung auf ein neues Abkommen
Die Hoffnung vieler Angehöriger und vieler Israelis insgesamt richtet sich auf Donnerstag. Die Vereinigten Staaten, Qatar und Ägypten wollen, dass Israel und die Hamas sich endlich auf ein neues Abkommen über die Freilassung und eine Waffenruhe einigen, und haben eine Verhandlungsrunde anberaumt. In den USA und in Israel geben viele die Losung aus, es handele sich um einen „Jetzt oder nie“-Moment. Aber ob die Gespräche stattfinden und wer daran teilnimmt, ist ungewiss.
Seit dem ersten Geiseldeal, der am 1. Dezember nach einer Woche zusammenbrach, ist eine Neuauflage gescheitert. Netanjahu sagt, an der Hamas – die Hamas sagt, an Netanjahu. Alle Akteure haben ihre Interessen; selbst die Vermittler, die darauf setzen, dass eine schnelle Einigung die befürchtete große Eskalation zwischen Israel und Iran und der Hizbullah verhindert. Bei der Hamas ist wenig darüber bekannt, was hinter den Kulissen geschieht – im Fall Israels knirscht es mit Blick auf den Geiseldeal inzwischen vernehmlich innerhalb der Regierung.
Die Geiselfamilien verfolgen das alles sehr aufgewühlt. Auf der einen Seite sind sie nicht diejenigen, die die Beschlüsse fassen, welche über Leben oder Tod ihrer Lebenspartner, Kinder oder Eltern entscheiden. Aber machtlos sind sie auch nicht – ihre Stimme wird in Israel und im Ausland sehr wohl gehört, und das versuchen sie zu nutzen.
Sehr viele Angehörige und ehemalige Geiseln engagieren sich in einer der Interessengruppen oder auf andere Art und Weise. Oft hilft ihnen das auch, mit ihrer Situation fertig zu werden: Viele von ihnen haben nicht nur Angehörige, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, sondern haben auch ermordete Familienmitglieder zu beklagen.
Ungeachtet des Chaos, das nach dem 7. Oktober herrschte, dauerte es nicht lange, bis die Geiselfamilien sich organisiert hatten. Als er wenige Tage nach dem Terrorangriff zum ersten Mal zum „Forum der Familien der Geiseln und Vermissten“ kam, habe es dort schon eine professionell aufgestellte Operationszentrale gegeben, erinnert sich Daniel Shek. Der 69 Jahre alte Israeli, ein ehemaliger Botschafter seines Landes in Paris, arbeitet seither für die „diplomatische Abteilung“ des Familienforums. Dort hält man Kontakt zu Botschaftern und Regierungen im Ausland – „auch zu einigen der Vermittlerländer“, wie Shek hervorhebt.
„Konsens ist keine sehr jüdische Sache“
Das Forum hat zwei große Aufgabenbereiche: Zum einen versucht es, die Interessen der Geiseln zu vertreten, öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Es hält Kontakt zu Politikern und organisiert Veranstaltungen wie die samstäglichen Kundgebungen auf dem „Geiselplatz“. Zum anderen kümmert es sich um Belange der Familien, organisiert medizinische und psychologische Betreuung, rechtliche und finanzielle Unterstützung.
Die allermeisten arbeiten ehrenamtlich für das Forum, und das mit großer Überzeugung. „Ich war dreißig Jahre lang Diplomat“, sagt Shek. „Aber noch nie habe ich das Gefühl gehabt, etwas so Bedeutungsvolles zu tun wie jetzt.“
Die Einheit währte jedoch nicht allzu lange. Bald begannen sich im Forum Risse aufzutun. Es ging darum, wie offen man Kritik an der Regierung üben sollte – und grundsätzlicher um die Frage, was der beste Weg ist, die Rückkehr der Geiseln zu erreichen. Manche fanden, das Forum müsse lauter sein, andere hatten den Eindruck, ihre Meinung werde von der Organisation unterdrückt. Darauf angesprochen, sagt Shek mit feinem Lächeln: „Konsens ist keine sehr jüdische Sache.“ Tatsächlich spiegelte sich innerhalb des Forums ein Konflikt wider, der in der ganzen israelischen Gesellschaft tobt.
Die Lösung des Familienforums war lange Zeit – und ist im Grunde bis heute –, unpolitisch zu sein. Das führte bisweilen zu seltsamen Situationen. Angehörige forderten auf Veranstaltungen des Forums, die Regierung müsse die Rückkehr der Geiseln erreichen – aber wenn man fragte, wie, gaben sie keine wirkliche Antwort. Shek sagt, innerhalb des Forums gebe es ständig Debatten und Streit.
Aber das trage man nicht nach außen. Auch auf den Samstagskundgebungen sprechen keine aktiven Parteipolitiker. Nur so könne das Forum funktionieren, glaubt Shek: „Wir wollen, dass möglichst viele Leute sich hier wohlfühlen.“ Das Forum sei „eine Gemeinschaft“.
Dennoch nahm die Kritik zu, auch von außen. Vor dem ersten Geiseldeal verstärkte das Familienforum seine öffentlichen Aktivitäten, hielt mehrere große Protestkundgebungen ab und organisierte einen mehrtägigen Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem. Das führte zu „sehr viel Kritik von sehr spezifischen Kreisen“, sagt Shek – gemeint ist die politische Rechte um Minister wie Bezalel Smotrich oder Itamar Ben-Gvir, die den später vollzogenen Geiseldeal ablehnte. Es kam zu ersten öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Geiselangehörigen und Politikern.
Druck auf die Geiselfamilien
Gil Dikman, ein Cousin zweier Geiseln, hatte einen emotionalen Auftritt in einem Knessetausschuss, in dem er an Ben-Gvir appellierte, die Entführten nicht zu gefährden. Damals habe eine „Kampagne“ gegen diejenigen Geiselangehörigen eingesetzt, die zu lautstark auftraten, sagt er einige Monate später im Gespräch. „Manche glauben, dass es Israel im Kampf gegen die Hamas schwächt, wenn wir über die Geiseln reden.“
Ziel der Kampagne sei gewesen, die Forderungen der Geiselfamilien zu politisieren – also zu einem Teil der generellen Auseinandersetzung zwischen der Regierung und dem Oppositionslager zu erklären. „Man versuchte, es so darzustellen, als wollten wir die Regierung schwächen“, sagt Dikman. „Zu glauben, dass es uns um irgendetwas anderes geht als darum, unsere Angehörigen zurückzubringen, ist für mich schlicht unbegreiflich.“


Allerdings schlossen sich manche Geiselangehörigen den Demonstrationen gegen die Regierung an, die eine Weile nach dem 7. Oktober wiederaufflammten. Dikman sagt, viele Kräfte zerrten an den Geiselangehörigen. Natürlich sei es angesichts dessen schwierig, die Neutralität zu bewahren. Wenn er sich politisch äußere, weise er in der Regel darauf hin, dass er das nicht als Vertreter des Familienforums tue.
Im Februar wurde unvermittelt verkündet, dass der Geschäftsführer des Familienforums zurücktrete, Ronen Tzur. Einem Medienbericht zufolge hatten 45 Familien in einer Petition seinen Rücktritt gefordert. Der ehemalige Abgeordnete und Kommunikationsberater sagte, Politiker hätten Druck auf Geiselfamilien ausgeübt.
Einige Zeit nach dem Vorfall sitzt Tzur in einem Büro in seiner Agentur in einem Hochhaus am Rande von Tel Aviv und blickt zurück auf die Zeit im Forum. Am 10. Oktober hätten einige Angehörige von Verschleppten ihn gebeten, eine Pressekonferenz zu organisieren. Dort hätten sich dann überraschend Dutzende Geiselfamilien eingefunden, zudem seien Hunderte Journalisten gekommen.
„Das war die schwerste Pressekonferenz meines Lebens“, sagt Tzur. „Alle weinten, die Angehörigen, die Journalisten . . .“ Anschließend richtete er für die Familien ein Callcenter ein. Binnen weniger Tage hätten sich dort Tausende Familien gemeldet, die um Hilfe baten. Zugleich boten etwa zehntausend Freiwillige ihre Unterstützung an. So entstand das Familienforum – und der Slogan: „Bringt sie jetzt zurück“.
„Höfliche Demonstrationen“
Er habe sich zwei Ziele gesetzt, sagt Tzur: Erstens, die Regierung davon zu überzeugen, dass die Rückkehr der Geiseln das wichtigste unter Israels Kriegszielen ist – also wichtiger als die Zerschlagung der Hamas. Und zweitens, dass das Schicksal der Geiseln den wichtigen Entscheidungsträgern auf der Welt ständig präsent ist – „vom amerikanischen Präsidenten über den Präsidenten von Ägypten bis zum Ministerpräsidenten von Qatar“.
Auch Tzur sagt, er habe schon nach einigen Wochen den Eindruck gehabt, der Regierung gefalle der Druck nicht, den das Forum aufbaue. Die Botschaft, die bei ihnen ankam, sei gewesen: Ihr seid zu aggressiv – ihr helft nur Yahya Sinwar, dem Hamas-Anführer. „Das hat mich schockiert“, sagt Tzur. Eine Woche vor seinem Rücktritt im Februar hätten ihm dann einige Angehörige gesagt, sie würden keine Interviews mehr geben. Zur Erklärung sagten sie, sie seien unter Druck gesetzt worden: Wenn sie ihre öffentlichen Aktivitäten nicht mindern würden, hätte das womöglich Auswirkungen darauf, auf welchem Platz der Liste ihre Angehörigen stehen, wenn es zu einem Geiseldeal kommen sollte.
Kurz darauf habe er beschlossen, sich zurückzuziehen, sagt Tzur. „Ich hätte nicht mit dem Gedanken leben können, dass auch nur eine Familie abends mit der Vorstellung schlafen geht, dass ihr Verwandter wegen mir oder wegen meines Teams nicht freigekommen ist.“
Tzur findet, dass die Aktivitäten des Familienforums inzwischen nicht kritisch genug sind. Er spricht von „höflichen Demonstrationen“, die der Regierung nicht wehtäten. Auch andere weisen darauf hin, dass auf dem „Geiselplatz“ in Tel Aviv das Gemeinschaftsgefühl immer mehr im Vordergrund stehe. Es sei religiöser geworden, es werde viel gesungen.
Zu den Kundgebungen an Samstagabenden ist es auf dem Platz vor dem Museum immer noch sehr voll. Auf großen Bildschirmen werden die Reden übertragen. Meist sind es sehr persönliche Ansprachen von Angehörigen an ihre verschleppten Verwandten. Immer wieder werden sie von „Jetzt“-Rufen unterbrochen: „Jetzt“ müssten die Geiseln zurückgebracht werden. Auf manchen Plakaten wird auch Kritik an Netanjahu geäußert.
Einschüchterungsversuche und Attacken
Auch manche der Installationen auf dem Platz haben ihre verstörende und berührende Wirkung nicht verloren, etwa der lange Nachbau eines Tunnels im Gazastreifen. Wenn man unter der Woche auf den Platz geht, ist es dort aber inzwischen oft ruhig. Eine Schülergruppe, die den Platz besucht, amerikanische Touristen. In dem Gebetszelt hinter dem Tunnel sitzen orthodoxe Männer und lesen in jüdischen Schriften. Auf dem Flügel in der Mitte, der für den entführten Alon Ohel aufgestellt wurde, einen klavierbegeisterten 22 Jahre alten Israeli, spielt jemand eine melancholische Melodie.
Yifat Kalderon benutzt ein hebräisches Wortspiel, wenn sie über den Platz spricht. Der „Geiselplatz“ sei eigentlich ein „Streichelplatz“, spottet sie. Das sei in Ordnung, aber sie habe nach etwas „stärker Aktivistischem“ gesucht. Kalderon war eine der Ersten, die das große Zelt des Familienforums verlassen haben. Dort heißt es über sie, Kalderon mache „ihr eigenes Ding“. Sie selbst sagt lapidar: „Ich demonstriere, aber ich mache auch andere Sachen – Reifen verbrennen und so.“ Alles, was dazu beiträgt, dass die Situation von 115 Geiseln im Gazastreifen „nicht normalisiert wird“.
Die 50 Jahre alte Israelin hat auch früher schon gegen die Regierung protestiert. Nach dem 7. Oktober hatte auch sie sich erst zurückgehalten – auf Bitten des Bruders ihres entführten Cousins, sagt sie. Nach 52 Tagen kamen Ofers Kinder im Rahmen des Geiseldeals frei. Der 53 Jahre alte Ofer sagte zum Abschied zu seiner 17 Jahre alten Tochter Sahar: „Geht raus, protestiert, tut alles, was möglich ist. Denn ich will hier nicht sterben.“
Als Ofer auch nach hundert Tagen immer noch nicht frei war, habe sein Bruder zu ihr gesagt: „Du kannst jetzt tun, was du willst.“ Seither demonstriert Kalderon täglich vor dem Armeehauptquartier. Anfangs war sie praktisch allein, seit Januar haben weitere Geiselfamilien sich ihr angeschlossen. Manche von ihnen waren früher Netanjahu-Anhänger.
Auch Yifat Kalderon berichtet von Einschüchterungsversuchen und Attacken gegen sie – in sozialen Netzwerken, aber auch auf der Straße. Sie kritisiert auch die Polizei, die hart gegen regierungskritische Demonstranten vorgehe. Von Netanjahu ist sie tief enttäuscht. Im Januar gab es ein Treffen Kalderons und weiterer Angehöriger mit dem Ministerpräsidenten und seiner Frau Sara. Er habe ihre Vorwürfe zurückgewiesen, dass er die Geiseln im Stich lasse, berichtet Kalderon.
Seine Frau habe die Angehörigen sogar kritisiert: Diese würden „den Preis hochtreiben“, weil sie mit der Presse sprächen. Kalderon sagt dazu: „Wenn sie denken, dass nicht jeder Preis gerechtfertigt ist, um die Geiseln zurückzubringen, dann fehlen mir dafür einfach die Worte.“
„Es ist an der Zeit für Israel, Stärke zu zeigen“
Diese Frage ist es, die die Israelis spaltet – auch wenn Umfragen zufolge etwa siebzig Prozent der Bevölkerung für einen Geiseldeal sind. Zvika Mor gehört zu denjenigen, die das ablehnen. Der 48 Jahre alte Israeli lebt seit 25 Jahren in der Siedlung Kiryat Arba in Hebron. Er hat acht Kinder, der 24 Jahre alte Eitan ist sein ältester Sohn.
Er war als Wachmann auf dem Supernova-Festival gewesen und wurde erst gegen Mittag in den Gazastreifen verschleppt. Die Familie sei „sehr stolz“ auf Eitan, sagt Zvika Mor. Er hätte fliehen können, half aber stattdessen stundenlang anderen. „Das ist die Erziehung in unserer Familie.“ Auch nach der Entführung hätten sie beschlossen, „stark und fröhlich und optimistisch“ zu bleiben.
Im Herbst gründete Mor das Tikvah-Forum – übersetzt „Hoffnung“. Auch er war mit dem Familienforum nicht zufrieden. „Sie haben uns nicht mit unserer ureigenen Stimme sprechen lassen.“ Mors Stimme, das ist die Stimme derjenigen, die glauben, dass der beste Weg zur Rückkehr der Geiseln militärischer Druck ist. Die Kernbotschaft des Tikvah-Forums lautet: „Wir finden nicht, dass den Terroristen irgendein Preis gezahlt werden sollte.“ Er wolle, dass Eitan „die letzte Geisel in der jüdischen Geschichte ist“, sagt Mor. Dafür müsse man Stärke gegenüber der Hamas zeigen und sie vernichten.
Drei Familien haben das Tikvah-Forum im November gegründet. Inzwischen hätten sich aber etwa dreißig Geiselfamilien der Gruppe angeschlossen, sagt Mor – „aus dem ganzen Land, religiöse und säkulare“. Von anderen Geiselangehörigen wird diese Behauptung bezweifelt. Unstrittig ist, dass die Familien aus dem Tikvah-Forum einen besseren Zugang zu Netanjahu haben als die meisten anderen – der Ministerpräsident wurde lange Zeit dafür kritisiert, dass er sich nicht oder nicht oft genug mit Geiselfamilien treffe.
Zvika Mor sagt, es sei an der Zeit für Israel, Stärke zu zeigen. „Wir sind auf dem Weg, alle Kriegsziele zu erreichen – aber es braucht Zeit.“ Mit Blick auf die Kritik anderer Angehöriger, dass die Geiseln keine Zeit hätten, sagt Mor: „Unserer Meinung nach geht es um das Leben von mehr als neun Millionen Israelis.“
Ihr Wohlergehen müsse sichergestellt werden – selbst wenn das auf Kosten des Wohlergehens der Geiseln gehe. Mor gibt sich aber sicher, dass es das Leben der Geiseln nicht gefähren werde, wenn Israel den Druck erhöhe. Die Hamas werde aufgeben. Und Eitan werde zurückkehren.