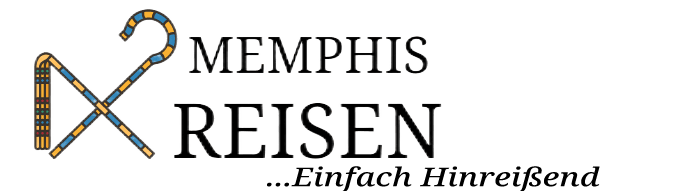Olympia-Eröffnungsfeier: Das sagt ein Verantwortlicher zur Kritik
Welche Rolle haben Sie bei diesem Projekt gespielt?
Wir mussten auf die Kohärenz der Erzählung achten und gleichzeitig den Künstlern die Möglichkeit geben, bei absoluter kreativer Freiheit das zu schaffen, was wir gesehen haben: Bilder, die, ich sage es noch einmal, Vorstellungswelten hervorrufen. Nun ist die Vorstellungskraft auch eine Tugend der Geschichtswissenschaft, und ihr bürgerlicher Wert macht sie zu einer Praxis der Gastfreundschaft. Für uns gab es zwei Elemente: die Stadt – und nicht das Land –, Bilder – und keine Geschichten. Am Ende entsteht dadurch aber natürlich ein Porträt von Frankreich und seiner Geschichte.
Nun, es gab ein Bild mit dem Titel „Sportivité“ (Sportsgeist), in dem große Kähne auftauchten, die die Gärten von Versailles darstellten. Das war aber im Fernsehen kaum zu erkennen. Versailles sollte damit wieder ins Herz von Paris rücken, eine urbanistische Versöhnung im Hinblick auf die Geschichte der Revolutionen – und schon der Wasservorhang, unter dem das erste Boot der griechischen Athleten hindurchfuhr, erinnerte an die Versailler Wasserspiele, die Grandes Eaux. Durch diese versailleshaften Gärten, die sich in ein urbanes Skate- und BMX-Stadion verwandelten, sollten historische Persönlichkeiten schreiten: Napoleon, Ludwig XIV., aber auch die Senegalschützen, die mittelalterlichen Bauern, die Gavroches, jene Straßenkinder aus Victor Hugos Romanen, und alle trieben Sport – wir hatten uns gedacht, damit einen allzu steifen Blick auf unsere Geschichte aufzulockern: „Lasst uns mit der Geschichte sportlich umgehen.“ Fröhlich, akrobatisch und überraschend sollten die historischen Bezüge durcheinanderwirbeln. Der Regen hat diesen Teil der Show leider unmöglich gemacht. Wenn das stattgefunden hätte, würden Sie mir jetzt viele Fragen dazu stellen.


Wenn man die Stadien hinter sich lässt und sich der Stadt zuwendet, verlässt man eine leere und neutrale Bühne und setzt sich dem fast grenzenlosen Netz an Bedeutungen aus, die den Pariser Raum ausmachen. Wie haben Sie sich an diese semantisch aufgeladene Umgebung angepasst?
Außerhalb des Stadions wurde die Stadt zu unserer Bühne. Die Seine ist der sprachgewaltigste Protagonist unserer Aufführung. Die Pariser Denkmäler werden immer mächtiger sein, als wir es uns anmaßen dürften. Also versuchen wir nicht, mit ihnen zu konkurrieren: Sie sprechen lauter, deutlicher, und zwar schon so lange, dass wir ihnen unmöglich eine andere Aussage unterschieben könnten. Wir zwingen also keine Bedeutung auf, wenn wir die Revolution in die Conciergerie tragen oder die Liebe auf dem Square du Vert-Galant inszenieren, dem „Geschlecht von Paris“, wie André Breton sagte – ich erinnere daran, dass 1924, im Jahr der letzten Olympischen Spiele in Paris, auch das Manifest des Surrealismus erschienen ist, was uns sehr inspiriert hat, da wir mit Assoziationen, visuellen Reimen und Assonanzen arbeiten wollten.
Manche haben in der Reiterin auf der Seine einen apokalyptischen Bezug erkannt, Symptom einer Angst, die unsere Zwanzigerjahre prägt, in diesem olympischen Waffenstillstand in einer Welt, die zwischen Krieg und Frieden zu wanken scheint. War das beabsichtigt?
Ich habe selbst zur Pest gearbeitet, also konnte ich schon erkennen, dass ein solches Bild den Tod heraufbeschwört. Ich denke aber, dass das Werk ein offenes ist. Die konzeptuelle und imaginäre Offenheit der Reiterin lässt sie geradewegs nach vorn reiten, weit von uns entfernt.
Kann man sagen, dass Sie mit dieser Arbeit versucht haben, eine große Erzählung oder gar einen Roman der Nation zu schaffen?
Es handelt sich fast wörtlich um einen „Flussroman“ der französischen Geschichte, wobei die gesamte Pariser Geschichte im Trocadéro mündet oder ihn überschwemmt. Die Selbstironie der Londoner Eröffnungsfeier von 2012 haben wir bewahrt. Die Feier beginnt mit dem Prolog: Der Fackelträger betritt das Stadion und stellt fest, dass er hier falsch ist. Es liegt ein Irrtum vor, das Stadion ist leer: Also muss er schnell ein anderes Ziel finden, aber auf den Straßen ins Stadtzentrum ist immer Stau – die nostalgische, verstohlene Andeutung an das Paris von Jacques Tati erinnert daran, dass das schon in den Fünfzigerjahren ein Problem war. Man nimmt die Metro, man gerät in ein paar Pariser Bredouillen, aber man überwindet sie wie in einem Videospiel mit der Hilfe dreier Kinder, und alles fügt sich.


Ja, das Bild, das uns von London 2012 im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich die Königin von England, die mit dem Fallschirm im Stadion landet. Wir weisen darauf hin, ohne bösen Willen natürlich, dass wir in Frankreich eher dazu neigen, Königinnen zu enthaupten. Der Kopf von Marie-Antoinette, der das Revolutionslied „ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra“ singt (es wird gelingen, die Aristokraten werden hängen), ist das ironische und keinesfalls fordernde oder aggressive Äquivalent zur Londoner Eröffnungszeremonie mit Elisabeth II. Aber auch hier gilt es, sich zu entspannen. Wir sind im Theater, das Blut ist nicht echt, alles wird offensichtlich übertrieben. Es handelt sich nicht einmal um eine historische Nachstellung, Königin Marie-Antoinette ist nicht nur eine enthauptete Märtyrerin, sondern auch eine Pop-Ikone. Die Inspiration ist eine höchst schauerliche, zutiefst französische. Es folgte das Bild „Enchanté“ (Verzaubert): Auf den Ufern des Square Barye (leider hat man es im Fernsehen nicht gut sehen können) standen riesige Köpfe von französischen Berühmtheiten, Marie Curie, Rotkäppchen, der Pantomime Marcel Marceau, Arsène Lupin und Marcel Proust. Das Ganze erinnert an satirische Zeichnungen, Karikaturen, eine weitere französische Tradition.
Da sind wir ziemlich weit vom Roman der Nation entfernt.
Ja, aber wovon ich seitdem lese, erlauben Sie mir, es etwas pathetischer zu formulieren, ist ein Gefühl des Stolzes. Und das bewegt mich zutiefst. Schon das von mir herausgegebene Buch „L’histoire mondiale de la France“ (Weltgeschichte Frankreichs) war für mich nicht nur eine Möglichkeit, das Erzählen mit dem kritischen Denken zu verbinden, sondern auch das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit und die Freude an der Welt zu versöhnen. Versöhnen, ja. Wiedergutmachen, vielleicht. Mit der Eröffnungsfeier verhält es sich, würde ich sagen, etwa genauso. Frankreich heißt die Welt willkommen, Athleten ziehen vorbei, und am Ende werden die Medaillen gezählt.
Einer der beeindruckendsten Momente der Eröffnungsfeier war, als Aya Nakamura auf dem Pont des Arts vor dem Institut de France gemeinsam mit der Garde républicaine sang und tanzte. Wie haben Sie diese Sequenz vorbereitet, die im Vorfeld in Frankreich besonders heftige Kontroversen ausgelöst hatte?
Wir haben uns dafür geschämt, dass die weltweit meistgehörte frankophone Künstlerin einer solchen Flut von Rassismus ausgesetzt war. Davon haben wir uns aber nicht schrecken lassen. Und vor allem: Aya Nakamura hat diesem Affront getrotzt. Wir wollten die Sequenz ohne Provokation und in aller Ruhe über die Bühne bringen. Aya Nakamura ist bewundernswert, weil sie getan hat, was sie tun musste. Sie hat die Académie française nicht in Brand gesteckt, sondern sie im strahlenden Glanz erleuchten lassen, sie verherrlicht und die ihr entgegenschreitende Garde républicaine zum Tanzen gebracht. Wer ist in diesem Fall der Gastgeber? Man trifft sich auf einer Brücke und tanzt. Dieses Bild könnte ein Punkt des Innehaltens sein. Vielleicht können wir in Zukunft aufhören, uns von einer identitären Rechten einschüchtern zu lassen, die in den sozialen Netzwerken sehr viel Krawall macht. Für wen und was spricht sie eigentlich? Die Rechten sagen, dass wir abgehoben seien – dabei ist der Boden doch genau da. Und selbst wenn er rutschig ist, gibt es junge Menschen, die unabhängig von ihrem Körper, ihrer Herkunft, ihren Schwierigkeiten tanzen und uns mit ihrer Energie anstecken. Genau das haben wir gesehen. Ich möchte glauben, und ich beginne es zu wissen, dass dieses Bild von Aya Nakamura, die die Garde républicaine zum Tanzen bringt, die ihre eigenen Lieder singt und sie mit Worten aus dem Aznavour-Chanson „For me, formidable“ verknüpft – „Je ferais mieux d’aller choisir mon vocabulaire, pour te plaire, dans la langue de Molière“ (Ich sollte meine Wörter dir zuliebe wohl besser in der Sprache Molières wählen) –, dass dieses Bild uns alle zusammenbringen kann.


Es wäre schwierig, dieses Gespräch ohne einen kontrafaktischen Exkurs fortzusetzen. Die Geschichte, die Sie zu erzählen versuchen, und die Embleme und Symbole, die darin vorkommen, hätten sie eine andere Bedeutung gehabt, wenn es dem Rassemblement National gelungen wäre, an die Macht zu kommen? Wie haben Sie diese Möglichkeit einbezogen oder vorweggenommen?
Es war unmöglich, das vorwegzunehmen. Als das im Raum stand und viele besorgt und verängstigt waren, Anfang Juni also, konnten wir unsere Produktion nicht mehr ändern. Wir hatten keine andere Wahl, als die Zeremonie so zu präsentieren, wie wir sie vorbereitet hatten, außer es wäre zu einem Katastrophenfall gekommen. Ich weiß nicht, was solche Feiern bewirken können. Aber ich kann nicht anders, als sie mit Walter Benjamins Verständnis der Bilder als Erscheinungen zu verstehen, die, wie ich bereits sagte, Punkte des Innehaltens sein können – „wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält“. Wir wollten ein Porträt zeigen, das ungefähr dem Moment entspricht, in dem wir leben.
Was wäre das für ein Moment?
Der Moment, das sind die Vergangenheitsfragmente, aus denen die Gegenwart besteht, aber auch die Zukunftssplitter, die sie erahnen lässt. Wie wollen wir zusammenleben? Und mit wem, womit gestalten wir das? Die Antwort: Wir nehmen, was wir haben, also unsere Unterschiede. In dieser verwundeten, leiderprobten Stadt gleicht sich nichts, aber alle Teile können zusammengefügt werden. Es regnet? Es wird uns trotzdem gelingen. Denn wir befinden uns nicht im Peking des Jahres 2008, wo die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele einer Machtdemonstration gleichkam. Ein fröhliches Durcheinander, das ist Frankreich. Und es gibt ohnehin keinen Plan B, so wenig es einen Planeten B gibt. Man kommt mit dem zurecht, was man hat. Und wir haben, glaube ich, ein ziemlich eindrucksvolles Bild vermittelt, das uns zeigt, dass die extreme Rechte nicht alle Schlachten gewinnen kann und dass sie diese hier vor allem nicht gewonnen hat. Daran müssen wir uns erinnern. Nicht nur, um sagen zu können, dass wir gewonnen haben, sondern damit aus diesem flüchtigen Sieg etwas folgt.
In seinem Roman „Middle England“ stellt Jonathan Coe die Eröffnungsfeier in London als einen verzauberten Moment der Kommunion aller Seelen Englands dar. Wie in einer griechischen Tragödie wird dieser Moment zum Höhepunkt einer Hybris, eines Stolzes, der an den Bruchstellen der britischen Identität nach dem Brexit zersplittert. Wenn die Feier die Spaltungen der französischen Gesellschaft inszeniert und überlistet, gehen wir dann nicht dasselbe Risiko ein?
Deshalb kommt es für mich nicht infrage, in irgendeinem seligen Optimismus eine Kommunionserfahrung zu schaffen. Wir sind die Töchter und Söhne der Desillusionierung. Desillusioniert von den Hoffnungen von 1998, dem harmonisch multiethnischen Frankreich des black-blanc-beur und seinen nicht eingehaltenen Versprechungen. Jonathan Coe warnt uns vor dieser Gefahr, und das war uns wichtig, als wir den Ablauf der Feier gestalteten. Weil wir vorgewarnt sind, lassen wir uns dieses Mal vielleicht nicht wieder vom kindlichen Wunsch berauschen, an die Hoffnung eines Festes zu glauben. Feiern schreiben keine Geschichte, aber nur selten werden die starken, fruchtbaren Momente der Geschichte, wie Marc Bloch sagte, nicht von mächtigen öffentlichen Ritualen begleitet.
Nach der Feier kam es zu einer Kontroverse, die von so unterschiedlichen Figuren wie Jean-Luc Mélenchon, den französischen Bischöfen und Elon Musk ausgetragen wird. Es geht um das Bild, das mit dem „Letzten Abendmahl“ gleichgesetzt wurde. Darin sehen einige einen Angriff auf das Christentum. Wollten Sie blasphemisch sein? Wie reagieren Sie darauf?
Keine Blasphemie und auch kein Spott. Wenn man sich irgendwann einmal beruhigt und nicht mehr unaufrichtig ist, muss man einsehen, dass wir uns über niemanden lustig machen, höchstens über uns selbst. Es mag Humor und Selbstironie geben, aber ganz sicher keinen absichtlichen Spott, der dem emotionalen Repertoire von Thomas Jolly auch völlig fremd ist. Er hat alles gesagt, was es zu diesem unterschwelligen Abendmahl zu sagen gibt, und ich verweise auf seine Ausführungen. Im ursprünglichen Ablaufplan gibt es nichts, was explizit auf Christliches hinweist. Wir haben vielmehr mit dionysischen Konnotationen gespielt – mit dem Faden, der sich zwischen dem olympischen Griechenland und Paris entspinnt, denn Dionysos, oder französisch Denis, ist der Vater der Sequana, der Göttin der Seine-Quellen. Dieser große Tisch ist ein Festmahl der Götter und wird zum Laufsteg einer ausgeflippten Modenschau.
Neben der offiziellen Fernsehübertragung gibt es eine parallele Verbreitung der Bilder im Internet. Durch Smartphones und über soziale Netzwerke entstehen zusätzlich Bilder, die direkt von den Athleten stammen. So wurden wir Zeugen eines in der Geschichte der Eröffnungsfeiern wohl noch nie dagewesenen Moments, als die algerischen Athleten auf ihrem Seine-Boot an den 17. Oktober 1961 erinnerten, das Massaker von Paris im Zuge des Algerienkrieges. Hatten Sie das geplant, oder war das eine Überraschung für Sie?
Das war natürlich nicht geplant. Aber ich bin als Historiker und als Bürger sehr glücklich darüber, dass eines der Bilder, die wir von dieser Feier im Gedächtnis behalten werden, von den algerischen Athleten selbst verantwortet wurde, und zwar im vollen Bewusstsein ihres Tuns. Natürlich war es unsere Idee, dass die Feier keine Ode an die Macht sein sollte. Militärische Macht, staatliche Macht, historische oder identitätsstiftende Macht – ich denke, man hat verstanden, dass das nicht so ganz unsere Art ist. Wir hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen – und davon gab es einige. Ich habe noch nie in einem so komplexen Umfeld gearbeitet, in dem alle möglichen Zwänge zusammenkamen – politische natürlich, aber auch soziale, organisatorische, technische, wirtschaftliche, ökologische. Das gehört dazu. Wenn ich Alleinentscheider und gänzlich verantwortlich sein will für das, was ich mache, dann kann ich auch einfach zu Hause bleiben und Bücher schreiben. So etwas Schwieriges habe ich also noch nie gemacht – das heißt, so etwas Interessantes habe ich noch nie gemacht.
Sie sagen, dass Sie keine Ode an die Macht schreiben wollten, aber da gibt es doch einen gewissen Widerspruch. Sie haben eine Show inszeniert, die den olympischen Geist, den Frieden, die Solidarität in den Mittelpunkt stellte. Man hat auf Brücken getanzt und Mauern überwunden. Um diese Show möglich zu machen, mussten aber in ganz Paris Barrieren errichtet werden. Zehntausende von Soldaten sorgten dafür, dass fünf Prozent der Stadt nicht zugänglich waren. Kann man das nicht als Metapher sehen, vielleicht für die Lage Europas? Muss man sich in einer zerrissenen Welt bewaffnen und Mauern bauen, um Frieden zu schaffen und frei zu sein? Müssen wir unser Verhältnis zur Macht überdenken?
Natürlich wussten wir das und hätten es aus Prinzip ablehnen können – aus Prinzip respektiere ich Prinzipien. Wir wussten, dass die Olympischen Spiele auch ein Anlass sein würden, um die neuen Techniken der Überwachungsgesellschaft zu testen, mit den berüchtigten QR-Codes, Drohnen und biometrischen Kontrollen. Wenn Sie in den letzten Wochen in Paris waren, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass es all dies gab, dass diese lästigen und beängstigenden Sicherheitstendenzen aber auch durch eine gewisse Ungenauigkeit der Ordnungskräfte abgemildert wurden, die aus Unwillen, mangelnder Gründlichkeit oder aus dem Wunsch, die Feier nicht zu verderben, keine wirklich drastischen Kontrollen durchsetzten. Sagen wir es so: Wir befinden uns noch nicht ganz in einem Roman von Alain Damasio, und das ist auch gut so.
Aus dem Französischen von André Hansen.