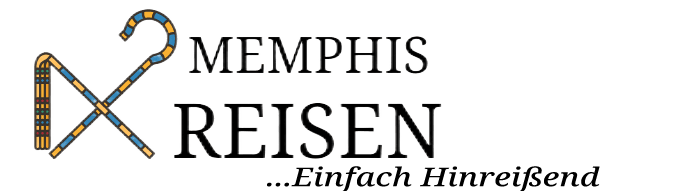Sahra Wagenknecht: Von der Außenseiterin zur Ikone


Schon als das BSW Ende Januar seinen Gründungsparteitag abhielt, deutete sich eine Wandlung an. Als Sahra Wagenknecht in einem feuerroten Kostüm auf die Bühne trat, jubelten ihr die Anwesenden zu, als wäre die Erlösung nahe. 2016 hatten Kritiker ihr auf dem Linken-Parteitag noch eine Torte ins Gesicht geworfen. Nun gab es Blumen und einen Friedenspreis. Von dem Streit und der Demontage, die Wagenknecht bei der Linken erheblich mitbetrieben hatte, war in Berlin nichts mehr zu spüren. Aus der Abtrünnigen schien eine Heilsbringerin geworden zu sein.
Am Sonntag bot sich ein ähnliches Bild. Nachdem die Hochrechnungen deutlich gemacht hatten, dass das BSW in Thüringen gut 15 und in Sachsen knapp zwölf Prozent der Stimmen erreicht hat, trat Wagenknecht in Erfurt unter großem Applaus auf die Bühne. „Was wir geschafft haben“, sagte sie, eine Partei, die aus dem Stand in zwei Landtage einziehe und das mit zweistelligem Ergebnis – das habe es noch nicht gegeben. „Da können wir alle stolz sein.“
„Ich bin klüger als die“
Dass Wagenknecht eine Masse hinter sich versammeln würde, war lange nicht absehbar gewesen. Im Vordergrund hatte ihr Außenseitertum gestanden. In einer jüngeren ARD-Dokumentation hebt Wagenknecht es noch mal selbst hervor. Ihre Kindheit und Jugend seien davon bestimmt gewesen, abseits von Gruppen zu stehen. Schon aufgrund ihres dunklen Aussehens sei es in Jena schwer gewesen, dazu zu gehören, erzählt die heute 55-Jährige. Sie habe sich in Bücher vertieft und eine Haltung der Stärke entwickelt: Kann mir egal sein, was die denken, ich bin klüger als die.
Die paramilitärische Ausbildung, die in der DDR auch Mädchen absolvieren mussten, war Wagenknecht zuwider. Dass sie dem Kollektiv kritisch gegenüber stand, entging dem Regime nicht. Ein Studienplatz wurde ihr unter Verweis darauf, der Gemeinschaft gegenüber nicht aufgeschlossen genug zu sein, zunächst verweigert.
Persönlich wirkt Wagenknecht scheu und unsicher
Den Äußerungen ehemaliger Parteikollegen zufolge gilt das ganz allgemein für Wagenknechts Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten. Für Gremien sei sie ungeeignet; es gebe kein gemeinsames Agieren. Wagenknechts Mutter wird in einer 2019 erschienenen Biografie mit der Einschätzung zitiert, eigentlich sei ihre Tochter gar keine Politikerin. Trifft man sie persönlich, wirkt sie tatsächlich nicht wie eine. Sie erweckt einen scheuen, fast unsicheren Eindruck, nicht den einer Frau, die gern in Talkshows sitzt und gegen die „dümmste Regierung Europas“ wettert.
Doch auch Populismus und Polemik gehören zu ihr. Es sind Eigenschaften die Wagenknechts Intelligenz, der auch ihre politischen Gegner Respekt zollen, nicht widersprechen. Ihre Klugheit zeichnet sich nicht nur dadurch aus, genau analysieren zu können. Wagenknecht versteht es auch, Emotionen zu verstärken. Besonders gilt das für Gefühle wie Hoffnung, noch mehr für Wut. Oft ist das Ressentiment ihr Treibstoff. Um daraus politisches Kapital zu schlagen, muss es auch plump zugehen. Nicht nur bei der Problembeschreibung, sondern auch bei den vermeintlichen Lösungen.
Der Soziologe Oliver Nachtwey schrieb jüngst in der F.A.Z.: Wagenknecht bespiele etwa „die Oben-Unten-Ungleichheit, indem sie diese mit Konflikten über Migration und Integration und mit solchen über Gleichstellung, Identität und Klima verkoppelt“. Jede Unterstützung für Migranten oder die Ukraine erscheine auf diese Weise als „Trade-off“, der dem Staat die Mittel entziehe, in Schulen oder Bildung zu investieren. So macht man aus Komplexitäten ein schlichtes Entweder-Oder.
Personenkult und kleine Parteibasis
Der Personenkult, von dem Wagenknecht dabei profitiert, hat sie schon immer umgeben. Ein Rudel ließ sich aber erst durch die Gründung einer Partei versammeln, die genau darauf baut. Das BSW hat nie auch nur versucht, das zu kaschieren. Alles ist auf die Vorsitzende ausgerichtet: vom Parteinamen über die Plakate bis hin zum WLAN-Passwort auf Wahlparties.
Die Basis des BSW ist klein, was bei einer so jungen Partei nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlicher ist, dass die Berliner Zentrale über Neuzugänge entscheidet und diese ein Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen. Aus dem BSW heißt es, die Partei solle langsam wachsen, Spinner und Extremisten wolle man fernhalten. Wagenknecht selbst sprach mehrfach von „Kinderkrankheiten“, die man vermeiden wolle.
Anders als bei den traditionellen Volksparteien dürfte die Basis für das Selbstverständnis des BSW außerdem zweitrangig sein. Dem Bündnis scheint es weniger darum zu gehen, als Mitgliederpartei zur gesellschaftlichen Integration beizutragen. Bedeutsam ist die Personalisierung. Und bislang gelingt sie. Wenn die Parteivorsitzende auf einer Wahlkampfveranstaltung auftritt, stehen die Menschen Schlange und bitten um Autogramme. Die Spitzenkandidatin des jeweiligen Bundeslandes rückt in den Hintergrund.
Offen ist, was Wagenknecht aus den Erfolgen in Sachsen und Thüringen nun macht. Vergangenen November äußerte sie in der Sendung Maischberger, auf das „Tun“ komme es an. Doch um eine Regierungskoalition einzugehen, muss man Kompromisse schließen können. Es braucht die Fähigkeit, die Wagenknecht oft abgesprochen wird: gemeinsam zu agieren. Sie selbst hat schon vor dem Wahltag eine Reihe bundespolitischer Bedingungen aufgestellt, die Kooperationen auf Landesebene schwer machen dürften. Unter anderem fordert Wagenknecht eine Absage an die Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland.
Ihr Unbehagen gegen eine Regierungsbeteiligung wird auch deutlich, wenn sie über die „Verantwortung vor dem Wählerwillen“ spricht. Die meisten Politiker verwenden diese Formulierung, wenn sie Macht anstreben. Wagenknecht will „Verantwortung“ dagegen auch als Schutz vor Frustration verstanden wissen. Es gehe darum, die Hoffnungen der Wähler nicht durch eine unbefriedigende Regierungsbeteiligung zu enttäuschen. Auch am Sonntag erwähnte sie diesen Vorbehalt. Man werde in keine Koalition eintreten, „wo die Menschen nachher enttäuscht sind“, kündigte sie in Erfurt an.