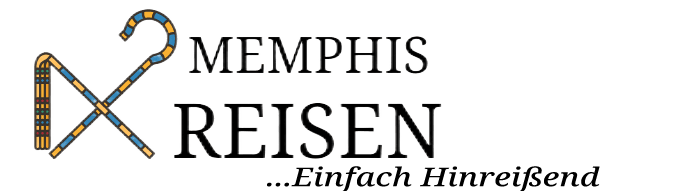Stark-Watzinger will militärische und zivile Forschung besser verzahnen
In anderen Ländern ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der zivilen und militärischen Forschung längst üblich und trägt entscheidend zu technischen Innovationen bei. Nun hat sich auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) dafür ausgesprochen. Sowohl die Münchner Sicherheitskonferenz als auch die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hätten gezeigt, dass es an der Zeit sei, die strikte Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung in Deutschland neu zu bewerten, sagte die Ministerin der F.A.Z.
Im vergangenen Jahr wie auch in diesem Jahr hatte die EFI Deutschland in ihrem Jahresgutachten aufgefordert, sich an der amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) zu orientieren, die für die Entwicklung risikoreicher und kostenintensiver Militärtechnologien zuständig ist. Als weiteres Vorbild wird die israelische Militäreinheit 8200 genannt, eine Einheit der Streitkräfte zur Fernmelde- und elektronischen Aufklärung, die etwa für Informationsgewinnung und Codeentschlüsselung verantwortlich ist. Nach dem Militärdienst gehen die israelischen Cyber-Soldaten in die Technologiebranche und machen dort Karriere. Diesen Veteranen verdankt Israel seine führende Stellung auf dem Markt der Cybersicherheit. „So können wir Synergien heben und unsere Innovationskraft stärken“, sagte Stark-Watzinger mit Verweis auf Israel und die Vereinigten Staaten. „Gerade in diesen Zeiten können wir uns nicht länger leisten, darauf zu verzichten“.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wolle anregen, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der zivilen und militärischen Forschung zu vertiefen, heißt es in einem Positionspapier, das der F.A.Z. exklusiv vorliegt. Das Format „Common Effort&Training“ etwa, das federführend vom Bundesministerium für Verteidigung verantwortet wird, hätte die zivil-militärische Zusammenarbeit schon im Blick. Die Ressourcen von Diplomatie, Sicherheitspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe sollen über die Ressort- und Ministeriumsgrenzen hinweg koordiniert und vermehrt werden. Es müsse geprüft werden, inwieweit Förderanreize für eine verstärkte Kooperation sinnvoll seien, sagte die Ministerin. „Eine Förderung von zielgerichteter militärischer Forschung durch das Bundesforschungsministerium ist dabei nicht geplant.“ Allerdings könne es auch keine Sicherheit ohne technologische und innovative Stärke geben.
Forschung vor Diebstahl schützen
Unter dem Leitgedanken „so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“, sei dafür Sorge zu tragen, dass die Maßnahmen zum Schutz der Forschungssicherheit in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken und Gefahren stünden, heißt es in dem Papier. Mit Forschungssicherheit sind nach einer Definition der G-7-Wissenschaftsminister Maßnahmen gemeint, Forschung vor Akteuren und Verhaltensweisen zu schützen, die ein „wirtschaftliches, strategisches und/oder nationales und internationales Sicherheitsrisiko darstellen“. Es geht um Risiken einer unzulässigen Beeinflussung, Beeinträchtigung oder widerrechtlichen Nutzung von Forschung, ebenso um den direkten Diebstahl von Ideen, Forschungsergebnissen und geistigem Eigentum durch Staaten, Militär und nichtstaatliche Akteure sowie um Aktivitäten der organisierten Kriminalität, die sich negativ auf die nationale Sicherheit auswirken.


Bettina Stark-Watzinger (FDP)
:
Bild: dpa
Konkret sollen deshalb die Selbstregulierungsinstrumente der Wissenschaft im Lichte der Zeitenwende überprüft oder gar revidiert werden. Der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG) und Leopoldina hat seine Instrumente schon angepasst. Auch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen plant gemeinsame Leitlinien für internationale Kooperationen. Das BMBF sollte diese Schritte aktiv begleiten und sich dafür einsetzen, „dass die Prüfung möglichst ganzheitlich, kohärent und unter Beteiligung der relevanten Sicherheitsbehörden sowie unter Identifikation internationaler Best Practices und Prüfung ihrer Transferabilität auf das deutsche Wissenschaftssystem erfolgt“, heißt es in dem Positionspapier.
Schon jetzt prüfen sicherheitsrelevante Forschungseinrichtungen sehr genau, mit welchem Forscher aus China sie kooperieren und wen sie zu Gastaufenthalten einladen. Doch was ist mit den chinesischen Forschern, die längst im System sind? Gerade die Helmholtz-Gemeinschaft kommt in ihren Instituten gar nicht ohne diese aus. Bisher fehlt es an Leitlinien und genauen Verfahren, vielmehr ist es den Einrichtungen selbst überlassen, mögliche Risiken zu überprüfen und einzuschätzen. Dazu holen sie sich auch juristische und exportrechtliche Expertise.
Es fehlt an Leitlinien
Das BMBF schlägt deshalb vor, eine zentrale Informationsplattform einzurichten, um Informationsquellen für Verdachts- und Hochrisikofälle (gegebenenfalls anonym) aufzubereiten. „Vorbild für einen Baustein einer solchen Plattform kann hierbei ggf. der vom Australian Strategic Policy Institute (ASPI) entwickelte China Defence Tracker sein“, heißt es in dem Text. Ähnlich hat Kanada im Januar 2024 eine Liste mit ausländischen Institutionen veröffentlicht, deren direkte oder indirekte Verbindungen zum Militär, zur Landesverteidigung oder zu staatlichen Sicherheitsorganen in Kooperationen ein Risiko für die nationale Sicherheit des eigenen Landes birgt. Vorstellbar wären auch für Deutschland Negativlisten für die Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftseinrichtungen.
Das BMBF verweist auf eine zentrale Clearingstelle als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Ressorts und Sicherheitsbehörden nach dem Vorbild des niederländischen National Contact Point for Knowledge Security. Sie könne wissenschaftliches Personal und Einrichtungen bei ihren Entscheidungen im Kontext von Forschungssicherheit und internationalen Kooperationen unterstützen. Das BMBF hat die Absicht, ein gemeinsames Verständnis der Ressorts der forschungssicherheitspolitischen Bedeutung verschiedener Technologien herauszuarbeiten und eine entsprechende Liste fortlaufend zu aktualisieren.
Zu den schwierigsten Aufgaben gehört es, das Wissenschaftssystem gegenüber nachrichtendienstlicher Informationsgewinnung widerstandsfähiger zu machen. Tagungen und offener Austausch über Landesgrenzen hinweg gehören zum Wesen der Wissenschaftskommunikation, aber die informelle Kontaktaufnahme bei solchen Zusammenhängen ist extrem anfällig für Kompromittierung und Überwachung digitaler Kommunikation.
Gemeinsam mit den Ländern und der Hochschulrektorenkonferenz will der Bund erörtern, ob Zivilklauseln unter den veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen noch angemessen sind und wie sie zweckmäßig ausgestaltet werden können. Derzeit verfügen noch zwei Länder (Bremen und Thüringen) in ihren Hochschulgesetzen über ein Zivilklauselgebot. Allerdings haben sich darüber hinaus viele Hochschulen eine Zivilklausel gegeben, als es in ihrem Land zeitweilig ein entsprechendes Gebot gab und sie dann in ihren Satzungen behalten. In den meisten Zivilklauseln ist von „ausschließlich friedlichen Zwecken“ die Rede, andere sind konkreter auf militärische und rüstungsrelevante Forschung bezogen.
In Bayern, wo es keine Zivilklauseln gibt, wurde Ende Januar ein „Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern“ beschlossen, das Zivilklauseln an Hochschulen untersagen und die Wissenschaft „aus Gründen der nationalen Sicherheit“ sogar zur Kooperation mit der Bundeswehr verpflichten soll.